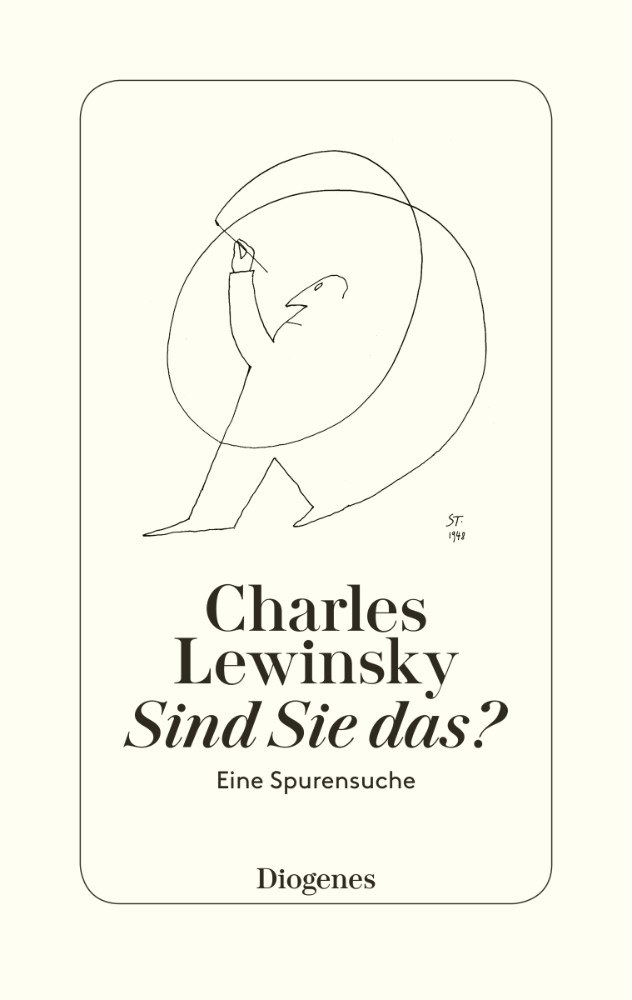
EIne Spurensuche
288 Seiten
2021, Verlag Diogenes
Seit mich einmal der Moderator einer Lesung vor versammeltem Publikum fragte, ob ich wohl selbst der pädophile Erzähler aus «Johannistag» sei, verfolgt mich die Frage: Wieviel Autobiografisches schmuggelt sich in Bücher ein, ohne dass der Autor es im Moment des Schreibens bemerkt? (Damit keine Missverständnisse aufkommen: Beim Stichwort Pädophilie ist das bei mir nicht der Fall.) Weil mir die erzwungene Corona-Quarantäne die Zeit dazu geschenkt hat, bin ich dem Rätsel mal auf den Grund gegangen. Ich habe alle meine Romane noch einmal durchgelesen und darin nach Relikten des eigenen Lebens geforscht. Das Ergebnis war eher eine Anekdotensammlung als eine Quelle tiefgründiger literarischer Erkenntnisse, und zu meiner Überraschung hatten fast alle dieser Fundstücke ihren Ursprung in meiner Jugendzeit.
Ich wollte diese Notizen eigentlich nur meinen drei wunderbaren Enkeln widmen, damit sie später einmal nachlesen können, was für ein schrulliger Mensch ihr Grossvater war. An eine Publikation hatte ich gar nicht gedacht. Aber als Diogenes das Ganze unbedingt als Buch herausbringen wollte, habe ich mich auch nicht gewehrt. Ein Titel war schnell gefunden. Er zitiert die Frage jenes Moderators von damals, der Autor und Figur verwechselte: «Sind Sie das?»
Noch eine Erinnerung aus Kindertagen, die ich eins zu eins in eine Geschichte übernommen habe – und wieder ist es eine, auf die ich nicht stolz bin. Mir scheint bei der Neubegegnung mit den eigenen Büchern, dass solche Zitate aus dem eigenen Leben mir immer wieder unbewusst dazu gedient haben, Erlebnisse, die ich lieber vergessen hätte, in die Quarantäne eines literarischen Textes einzusperren und damit zu neutralisieren.
In der Geschichte vom Wörtersammler erinnert sich ein Mann an seinen geistig behinderten Bruder, der unter der Naziherrschaft der Euthanasie zum Opfer gefallen ist:
Der Ernst hat sich eigentlich über alles gefreut. Er hat immer gelacht. Nur wenn man mit dem Finger auf ihn gezeigt hat und gesagt: Bumm, bumm, du bist tot! – dann hat er einen Wutanfall bekommen. Bevor er ins Heim kam, haben ihn die Buben auf der Straße immer damit geplagt.
Diesen geistig behinderten Ernst – wenn ich mich richtig erinnere, hieß er wirklich so und wurde Ernstli genannt – hat es tatsächlich gegeben, und ich gehörte zu den Buben, die ihm auflauerten, um ihn zu plagen. Ich weiß, das ist kein hochdeutsches Wort, aber hier ist der Dialekt einfach präziser.
In der Primarschulzeit verbrachte ich den Sommer regelmäßig in einer Ferienkolonie im appenzellischen Heiden. Das Wartheim – das in Melnitz ausführlich vorkommt – hatte zwei Sorten Bewohner: die „festen“ Kinder, die das ganze Jahr dort wohnten und auch in Heiden zur Schule gingen, und uns „Kolonisten“ die für ein paar Ferienwochen in einem eigenen Gebäude untergebracht wurden.
Heiden war kein Ort, der uns Ferienkolonisten viele Attraktionen zu bieten hatte, aber immerhin gab es den Ernstli. Diejenigen, die jedes Jahr wieder kamen,
freuten sich auf ihn, wie man sich auf die Wiederkehr der Geisterbahn beim nächsten Jahrmarkt freut. Es kam uns überhaupt nicht in den Sinn, dass es ein bemitleidenswerter Mensch war, den wir da immer wieder zur tobenden Verzweiflung trieben. Kinder können sehr sadistisch sein, und ich war keine Ausnahme.
Die „festen“ Kinder wussten, um welche Zeit der Ernstli zu erwarten war. Ich meine, es sei immer am späteren Nachmittag gewesen, aber in solchen Details ist meiner Erinnerung nicht zu trauen. (In den Hauptsachen, fürchte ich, auch nicht immer.) Wenn es diese Regelmäßigkeit überhaupt gab, dann erkläre ich sie mir im Nachhinein so: Es wäre denkbar, dass der Ernstli seine Tage in einer betreuten Einrichtung in Heiden verbrachte, und sich gegen Abend auf den Heimweg zu seinem unterhalb des Dorfes gelegenen Wohnort machte. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich ihn jemals die steile Straße, die am Wartheim vorbeiführte, habe hinaufgehen sehen; wenn ich mir die Situation ins Gedächtnis zurückrufe, kam er immer von oben herunter.
Und immer wieder mal wartete eine Kinderhorde auf ihn.
Ich kann den Mechanismus nicht erklären, der aus einer Gruppe eine Horde macht, ich weiß nur, dass die Veränderung sehr schnell vor sich gehen kann. Es genügt, dass jemand, der nicht zur Gruppe gehört zum Feind erklärt wird. Oder zum Opfer, so wie der Ernstli. Eine kleine Spur Angst spielt dabei wohl immer mit, die angenehm kitzelnde Sorte Angst, die auf dem Gefühl der Übermacht beruht, und auf der beruhigenden Gewissheit, dass einem nicht wirklich etwas passieren kann. Ob sich das Opfer wehrt oder nicht, spielt keine Rolle, das eine steigert die Angst und das andere das Machtgefühl, und beides kann sehr schnell zu Gewalt führen.
Beim Ernstli war es einfach. Man musste nur mit ausgestrecktem Zeigfinger wie mit einer Pistole auf ihn zeigen und „Bumm, bumm, du bist tot!“ rufen – und schon geriet er in eine uns ebenso erschreckende wie amüsierende Panik, die wir nur schon deshalb auskosteten, weil wir wussten, dass wir im Grund etwas Verbotenes taten. Wenn ich mich daran erinnere, kann ich verstehen, warum sich in früheren Jahrhunderten die Zuschauer zu öffentlichen Hinrichtungen drängten. Und sich heute noch drängen würden, wenn sie die Gelegenheit dazu hätten.
Ob sie sich hinterher auch für ihr Vergnügen schämten?
Zurück zur Übersicht

