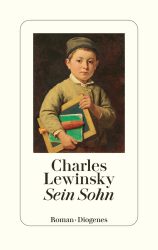
Sein Sohn
288 Seiten
2022, Verlag Diogenes
Mein Freund Michael van Orsouw, der es wie wenige Historiker versteht, geschichtliche Fakten zu vergnüglich lesbaren Texten zu verarbeiten, hat in einem Buch mit dem Titel «Blaues Blut» all die gekrönten Häupter beschrieben, die einmal die Schweiz besucht haben. Bei der Lektüre stiess ich auf den späteren «Bürgerkönig» Louis Philippe, der auf der Flucht vor der Guillotine unter dem Pseudonym Louis Chabos in einem bündnerischen Internat Französischlehrer wurde. Und mit der Köchin dieses Internats einen Sohn zeugte.
Von diesem Buben kennt die Geschichte noch nicht einmal den Namen. Man weiss nur, dass er gleich nach der Geburt in einem Mailänder Waisenhaus abgegeben wurde – dann verliert sich seine Spur.
Da gab es also, wie es sonst nur in Märchen passiert, einen Waisenknaben, der in Wirklichkeit in Königskind war. Wahrscheinlich hat er von dieser Verbindung nie etwas erfahren. Aber was wäre, wenn? Wie würde so ein Mensch reagieren, wenn er eines Tages erführe, dass sein Vater der König von Frankreich ist
Die Frage war zu interessant, um nicht den Versuch einer Antwort zu machen. Und so habe ich mich hingesetzt und die Lebensgeschichte dieses unbekannten Königssohns erfunden. Die Geschichte eines Menschen, die ganz anders verlaufen würde, wenn er nicht «sein Sohn» wäre.
Übersetzungen:
Arabisch
Die Totengräber arbeiteten langsam. Wenn das Brot knapp wird, muss man die letzten Bissen einteilen.
«Eine einzige Leiche heute», sagte der Alte. «Die Krankheit gönnt uns nichts mehr.»
«Die Seuche geht zu Ende», sagte der Junge.
«Wir wollen es nicht hoffen», sagte der Alte.
Der Tote lag auf dem Rücken. Die Augen offen. Einer, der am falschen Ort aufgewacht ist. Er passte nicht nach St. Ouen, wo manche nichts haben und viele noch weniger. Alle andern waren ausgehungert gewesen. Nicht gut genährt wie der Mann, für den sie da in dem lehmigen Boden ein Loch gruben. Der falsche Körper für ein Armengrab. Wer zu essen hat, stirbt nicht allein. Ein gedeckter Tisch findet leicht Gesellschaft.
Dass man seine Leiche auf der Straße gefunden hatte, bewies nicht das Gegenteil. Auch nicht, dass er nackt gewesen war. Man hatte sich an ihm bedient. Das war nur vernünftig. Einen Toten machen auch Seide und Samt nicht gesund.
«Leute wie der», sagte der Alte, «werden sonst in Särgen angeliefert.»
«Nackt braucht er weniger Platz», sagte der Junge.
«Auch wieder wahr», sagte der Alte.
Die Stiele der Schaufeln kalt in ihren Händen. Der Winter schlich sich in die Stadt, wie sich die Cholera eingeschlichen hatte. Nur dass man vom Frieren langsamer starb.
Ein Schluck Fusel hätte jetzt gewärmt, aber den letzten hatten sie gestern getrunken. Auch Tabak hatten sie keinen mehr. Bevor das Grab zugeschaufelt war, gab es kein Geld.
«Müssen wir auf den Priester warten?», fragte der Junge.
Er bekam keine Antwort. Hatte auch keine erwartet. Ein Gebet am Grab kostete einen Franc. Zwei Kilo Brot. Der Tote hatte kein Geld, wenn es ihm nicht zwischen den Arschbacken steckte.
Bevor sie ihn zum Grab schleppten, das war ihre Gewohnheit, stützten sie sich auf ihre Schaufeln und erfanden ein Leben für ihn. Wem die bessere Geschichte einfiel, durfte die Leiche unter den Achseln fassen. Der Verlierer musste die Beine nehmen.
«Du fängst an», sagte der Alte. «Ich war gestern der erste.»
«Und dann war ich dran», sagte der Junge, «und dann wieder du und wieder ich und wieder du und wieder ich.»
«Sechs Leichen»; sagte der Alte. «Das war ein guter Tag.»
«Es ist noch nicht Mittag», sagte der Junge.
Von der Kapelle her erklang die kleine Glocke.
«Siehst du», sagte der Junge. «Wieder einer.»
«Nicht für uns», sagte der Alte. «Auch das Läuten muss bezahlt werden.»
Die weißen Wolken ihres Atems stiegen senkrecht in die Höhe. Immerhin kein Wind.
«Eigentlich bin ich Pastetenbäcker», sagte der Alte.
«Eigentlich bin ich Napoleon», sagte der Junge. «Fang endlich an.»
«Vierzig Jahre alt.»
«Mehr.»
«Das täuscht», sagte der Alte. «Die Seuche macht die Gesichter älter. Du bist dran.»
«Verheiratet. Zwei Kinder.»
«Und stirbt allein?»
«Die Krankheit hat sie vor ihm erwischt.»
Wenn der Alte lachte, musste er husten. Würgte gelben Schleim. «Ein Punkt für dich.»
«Du bist dran.»
«Tuchhändler. Frühstückt im Bett und diniert im Procope.»
«Wie kommt so einer nach St. Ouen?»
«Hier sind die Bordelle billiger.»
Der Junge stieß die Leiche mit der Stiefelspitze an. «An der rechten Hand hat er nur zwei Finger. Er muss falsch geschworen haben.»
«Wenn einem davon die Finger abfielen», sagte der Alte, «die Strassen wären voll davon.»
Es fing an zu schneien, und so machte ihnen ihr Spiel keinen Spaß mehr. Sie warfen den Toten ins Loch. Schaufelten ihn zu, ohne entschieden zu haben, was für ein Leben er gelebt haben könnte.
Kritik Neue Zürcher Zeitung
Er stemmte sich gegen seine Geburt. Statt kopfvoran lag er mit den Füssen voran in der Gebärmutter. Er wollte nicht hinaus. Und darum drohte höchste Gefahr. Der Gynäkologieprofessor machte im Kreis seiner Studenten daraus eine kleine Vorführung – und zerrte das Kind mit beherztem Griff eigenhändig aus der Mutter heraus. Der Bub lebte, die Studenten staunten und applaudierten. Der Applaus jedoch galt nicht dem neuen Erdenbürger. Denn der zählte nichts. Der Professor wird sich verneigt haben, nicht vor der Gebärenden, die war ihm gleichgültig, aber vielleicht vor den Studenten.
Wir schreiben das Jahr 1794, der spätere französische König Louis-Philippe I. hatte mit der Köchin Marianne Banzori ein Kind gezeugt, das in Mailand etwas ruppig zur Welt kam und gleich nach der Geburt in ein Waisenhaus gegeben wurde. Louis Chabos hiess der Kleine, nach dem Pseudonym seines Vaters. Und das ist auch schon alles, was die Geschichtsbücher über ihn wissen. Den Rest seiner Lebensgeschichte erzählt – beziehungsweise erfindet – Charles Lewinsky in seinem neuen Roman «Sein Sohn».
Drei Finger für Napoleon
Man kann nicht sagen, dass er dem Heranwachsenden, dem jungen Soldaten und später dem Mann in seinem besten Alter ein einfaches Leben andichtet. Aber der Alltag war in den Jahren und Jahrzehnten nach der Französischen Revolution für die meisten beschwerlich und bedrohlich. Nur hat sich Lewinsky für das Waisenkind ein geradezu exquisit grausames Schicksal ausgedacht.
Immer dann, wenn man glaubt, es winke Louis Chabos endlich das Glück, lässt der Autor ihn ein wenig daran kosten und die Leser sich daran erfreuen, ehe er ihn in die Abgründe der Zeit zurückstösst und an die Ruchlosigkeit der Mitmenschen ausliefert. Es soll dem Mann nur bloss nicht zu wohl werden in seiner Haut und seinem Leben.
Louis Chabos musste erst Napoleons Russlandfeldzug überleben und auf dem Rückzug drei Finger verlieren, ehe ihm das Motiv seiner Rastlosigkeit allmählich ins Bewusstsein drang. Bereits im Waisenhaus hatte er davon geträumt, dass dereinst ein Abgesandter eines märchenhaften Königs auf der Suche nach dessen verlorenem Kind auf ihn stossen würde. Er, der weder Mutter noch Vater je gesehen hatte, kannte keinen sehnlicheren Wunsch als diesen: seine Eltern zu finden. Und da sie augenscheinlich nicht nach ihm suchten, würde er sie finden müssen.
Die Suche nach den verlorenen Eltern führt den jungen Mann durch halb Europa und durch die aufwühlendsten Jahrzehnte der europäischen Geschichte. Für ein paar Jahre hält sich Chabos nach einer langen Odyssee in Zizers auf, er wird Familienvater und respektiertes Mitglied im Dorf, er ist ein erfolgreicher Winzer und bewährt sich als umsichtiger Helfer auch im Hungerwinter 1816/1817. Fast scheint es, als habe er den Ort gefunden, wo er hingehört.
Mit viel Geschick und erzählerischer Routine treibt Charles Lewinsky seine Geschichte in rasendem Tempo und kurzatmigen Kapiteln voran. Er weiss, wie man Spannung aufbaut, und er weiss zugleich, dass der Leser zwischendurch auch etwas Entspannung braucht. Er soll leiden mit dem Helden, aber er soll sich auch freuen dürfen, wenn dem Mann eine Ruhepause vergönnt ist.
Die Geburt des Individuums
Es ist nicht ohne Hintersinn, dass Lewinsky diese im Grunde zeitlose Geschichte einer Suche nach Mutter und Vater in die nachrevolutionäre Zeit verlegt hat. Denn er zeigt mit Louis Chabos auch ein Individuum von aufklärerischem Zuschnitt. Nicht umsonst taucht da und dort der Name Voltaires auf: Chabos ist ein Kind seiner Zeit. Er ist nicht nur revolutionär gesinnt, er besteht darauf, auch wenn er es so nicht zu formulieren wüsste, ein Individuum zu sein.
Er will nicht Opfer sein, sondern Herr über sein eigenes Schicksal. Lewinsky zeigt diese Entwicklung als einen langsamen Prozess der Bewusstseinsbildung. An entscheidenden Wegmarken seines Lebens sind es Begegnungen mit starken Figuren, die Chabos prägen und ihm sanft die Richtung zu sich selbst weisen. So wird die Geschichte von der Suche nach den Eltern eine Geschichte der Selbstfindung. Die Antwort auf die Frage, wer er ist, findet Chabos in sich selbst.
Lewinsky lässt uns an einer schweren Geburt teilhaben. Sein Roman aber erzählt noch von einer ganz anderen Geburt: wie das Individuum hervorging aus der gesichtslosen Masse. Und wie das moderne Ich immer neu zu sich selbst finden muss. Unterhaltsamer und bewegender war Existenzphilosophie nie.
Roman Bucheli
Kritik Berliner Morgenpost
Die Welt hat wahrlich nicht gewartet auf dieses Geschöpf. Und hat dafür auch keinen Platz. Sie zeigt sich ihm kalt, abwehrend und voller Pein. Das zeigt sich schon bei der Geburt dieses Louis Chabos anno 1794, im letzten Jahr der Schreckensherrschaft im fernen revolutionären Frankreich, die in Mailand von einem Arzt öffentlich, vor seinen Assistenten, durchgeführt wird. Und bei der die Hebamme bei jedem Schrei der Frau auf dem Gebärstuhl zusammenzuckt. Aber einem Professor der Medizin widerspricht man nicht. Schon gar nicht als Frau.
Ein Franzosenbalg. Schon vor der Geburt von der Mutter, einer einfachen Köchin aus Graubünden, fürs Waisenhaus bestimmt. Der Vater unbekannt. Auch die Mutter Oberin will sich eigentlich nicht noch um ein weiteres Kind kümmern. Sie muss schon 50 Mäuler stopfen. Aber immerhin, das Kostgeld ist auf 18 Jahre im Voraus bezahlt. Da muss man halt die Rationen schmälern. Selbst die Hebamme, die das Baby stillen soll, läuft bald davon. Und als der Junge heranwächst, wird er als „Giuseppini“, wie die Kleinsten der Kleinen im Heim genannt werden, von den älteren Buben gehänselt, gepiesackt und verprügelt.
Es ist eine harsche Jugend, die Charles Lewinsky in seinem neuen Roman „Sein Sohn“ in wenigen Kapitel aufblättert, eine Kindheit ohne Kindheit. Einen kleinen Lichtschimmer in dieser dunklen Welt sieht Louis, als ein verarmter Adliger, der alles verkaufen musste und nur noch in leeren Sälen wohnt, ihn aufnimmt. Weil er sich keine Diener mehr leisten kann. Der bringt ihm Stolz bei und wie man sich wehren muss. Aber er stirbt viel zu früh. Und die Älteren lauern schon, als Chabos ins Heim zurückkehrt. Also gibt es nur eins. Davonlaufen.
„Sein Sohn“ ist ein klassischer Entwicklungsroman. Aus einer Zeit allerdings, in der keine Entwicklung möglich scheint. Wie ein tumber Tor, ein Seelenverwandter des Simplicissismus, stolpert dieser Chabos durch die Weltgeschichte, reißt aus, gerät an viele Außenseiter und Ausgestoßene, an Versehrte und Vagabunden, an Hungernde und Hochstapler, bis er schließlich in den Krieg zieht. Auch das wie Simplicissimus im Dreißigjährigen Krieg, nur hier eben in den Napoleonischen Kriegen. Obwohl er erst 16 ist und viel zu klein, um als Soldat zu taugen, wird er in Napoleons Grande Armee aufgenommen.
Aber „Grande“ ist hier gar nichts. Bei seiner ersten Schlacht kommt er nie an. „Es gab zu viele davon. Vielleicht“, vermutet der auktoriale Erzähler ironisch, „hatte der Kaiser den Überblick verloren.“ Auch beim Russlandfeldzug wird Moskau nicht eingenommen, sondern nur eine brennende Stadt vorgefunden. Und dann kommt der Winter und der lange, endlose Weg zurück. Bei dem ganze Heerscharen auf der Strecke bleiben. Oder einen Schaden fürs Leben davontragen. Wie Louis Chabos.
Wer sich überraschen lassen will von einem neuen Lewinsky, dem Meister des Fabulierens, der mit wenigen Pinselstrichen eine ganze Welt und auch ferne Zeiten hinzutupfen und auszumalen weiß, wer es liebt, sich bei der Lektüre auf eine Reise ins Unbekannte zu machen, der möge an dieser Stelle einhalten und nicht weiterlesen. Der Schriftsteller gibt aber selbst früh erste Hinweise, worauf sein Roman, wenn auch spät, hinausläuft. Gleich anfangs mit dem Buchtitel „Sein Sohn“ und dem Possessivpronomen, das ja sogleich eine grundlegende Frage evoziert: um wessen Kind es sich hier handeln soll.
Und schon im Heim wird den Waisenknaben von einem der gestrengen Lehrer das Märchen erzählt von einem Bub, dem es noch schlechter ergeht, weil er in keinem Heim unterkommt. Bis eines Tages ein Herold im Auftrag des Königs herbeireitet, auf der Suche nach einem Kind mit Muttermal, auf der Suche nach dem Sohn des Königs. Auch die Niedrigsten können erhört werden, so die Botschaft, die Trost spenden soll. Aber das Leben ist halt kein Märchen. Schon gar nicht in jenen finsteren Zeiten. Und Trost, das wird einem hier schnell klar, wird sich nicht finden.
Es gab ihn wirklich, diesen Louis Chabos. Aber es ist nicht viel über ihn bekannt. Außer seine Abstammung. Das lässt Spielraum für Vermutungen und erzählerische Fantasie. Erst vor zwei Jahren erschien von Lewinsky „Der Halbbart“, ein dickleibiger Schmöker, in dem der Schweizer Autor den Gründungsmythos der Schweiz gehörig und mit saftiger Ironie umschrieb. Und sich einmal mehr als Chronist seines Landes wie auch des dortigen Judentums erwies.
Sein berühmtester Roman ist nach wie vor „Melnitz“, seine Chronik einer jüdischen Kaufmannsfamilie, die auch in der Schweiz unter dem Antisemitismus und dem Holocaust im Nachbarland leidet. Gefolgt von „Gerron“, der das Unfassbare fassbar machte: die Grauen des Konzentrationslagers, erzählt von einem ihrer Opfer, dem Schauspieler Kurt Gerron, mit der einzigen Waffe, die dem Komiker im Angesicht des Grauens bleibt: dem Galgenhumor.
Auch mit 76 Jahren schreibt Lewinsky noch immer mit großer Schaffensfreude und nie nachlassender Erzähllust. Anfangs nimmt der Autor, wie beim „Halbbart“, die Perspektive eines unschuldigen Jungen ein, der eine schuldige, grausame Welt erleben und begreifen muss. Und wie in allen seinen Werken geht es wieder um die Frage nach Identität, Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit, nach Integration und Ausgrenzung. Eigentlich sind alle Romanfiguren Lewinskys Verwaiste, Entwurzelte. Zumindest im übertragenen Sinn. Hier aber ist es das einmal ganz wörtlich.
Und so wird dieser „Sohn“ zu einer tragischen Figur – und die Flucht aus der Verwaist- und Verlorenheit zu einer Odyssee, die exemplarisch diese verheerende Epoche reflektiert. Und der dann in der kleinen Schweiz ein überraschendes Glück beschieden ist. Bis sich Louis Chabos doch noch auf die Suche nach seinem Vater macht. Und alles verspielt, was er erreicht hat. Ein Anti-Märchen also, das, wie so viele Märchen, finster beginnt, dann ein märchenhaftes Ende findet – aber noch lange nicht zu Ende ist. Sondern zu einer Parabel der Sinnlosigkeit und Desillusionierung wird.
Wieder mal ein echter, praller, packender Lewinsky, den man nicht aus der Hand legen möchte.
Peter Zander

