Glosse des Monats Januar
Die, die unten sind, wollen nach oben, die, die oben sind, wollen oben bleiben, und so oder so endet es immer damit, dass man sich ins Gesicht spuckt oder tritt.
Elena Ferrante
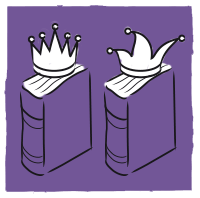
(Eine Rangliste der fünfhundert wichtigsten Intellektuellen ist zwar völliger Unsinn. Die Zeitschrift „Cicero“ hat sie trotzdem publiziert.) ‒ Herr Lewinsky, Sie sind nun also der vierhundertsiebenundfünfzigst-wichtigste Intellektuelle deutscher Sprache…
‒ Der vierhundertsechsundfünfzigste! Haben Sie nicht gesehen, wie ich Elisabeth Bronfen im Endspurt noch überholt habe?
‒ Im Gedränge vor der Ziellinie war das schwer zu erkennen.
‒ Gedränge? Was manche Kollegen da angestellt haben, war schon Rempelei. Eindeutig regelwidrig. Aber die Schiedsrichter haben ja Tomaten auf den Augen.
‒ Sie meinen: Wenn es nach den Regeln gegangen wäre, hätten sie eine bessere Platzierung erreicht?
‒ Vierhundertfünfundfünfzig, mindestens. Wenn nicht vierhundertvierundfünfzig. Aber den Platz hat sich ja Judith Schalansky ertrickst.
‒ Was sagen Sie zu Ihrem eigenen, doch recht schwachen Abschneiden?
‒ Schwach? Ich muss doch sehr bitten! Immerhin habe ich es – im Gegensatz zu einem Haufen Kollegen, die ich nicht nennen will – bis in die Liste geschafft. Nicht jeder hat in seinem Kleiderschrank ein T-Shirt mit der Aufschrift „Einer von 500“!
‒ Aber aufs Siegerpodest sind Sie nicht gekommen. Noch nicht einmal in die Nähe des Seriensiegers Martin Walser.
‒ So etwas wie Eifersucht kenne ich nicht und will deshalb auch niemand verdächtigen – aber hat mal jemand eine Urinprobe von Walser gesehen? Hä?
‒ Sie meinen … Doping?
‒ Der Mann wird dieses Jahr neunzig! Da fragt man sich schon, wie er ohne Hilfsmittel… Aber ich will nichts gesagt haben.
‒ Und Peter Sloterdijk auf dem zweiten Platz?
‒ Wie gesagt, ich gönne jedem seinen Erfolg. Aber dieser Name… Sein Vater soll ja Holländer sein. Warum wird so jemand überhaupt zugelassen?
‒ Auf dem dritten Rang ist Peter Handke.
‒ Ein lieber Kollege. Wirklich ein sehr lieber Kollege. Und an den Gerüchten, dass er beim Vordenken heimlich Wikipedia benutzt haben soll, ist bestimmt nicht dran.
‒ Sie meinen, dass Handke…?
‒ Nein, natürlich nicht. Ich sage nur: Es gibt Gerüchte. An die ich natürlich nicht glaube. Denn so etwas wie Eifersucht – das kennen wir Intellektuellen überhaupt nicht.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 29. Januar 2017,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats Februar
Ein Fremdwort ist wie ein unscharfes Foto.
Heinrich Waggerl
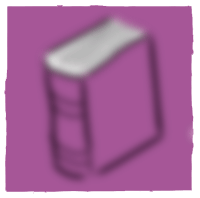
Als ich vor fast fünfzig Jahren, mitten in den Aufregungen der Achtundsechziger-Jahre, in Berlin studierte, begrüsste uns ein Professor einmal mit diesem schönen Satz: „Die Präparation dieses Seminars war arbeitsökonomisch nicht realisierbar.“
Er hätte auch einfach sagen können: „Ich habe mich nicht vorbereitet“ – aber das wäre ihm wohl zu unwissenschaftlich vorgekommen.
Diese Methode, Einfaches bewusst kompliziert zu sagen, um damit eine nicht vorhandene Gedankentiefe vorzutäuschen, war damals gerade die aktuelle Sprachmode, aber die Unsitte hatte eine alte Tradition. Schon der Meisterspötter Karl Kraus machte sich immer mal wieder einen Spass daraus, besonders gedrechselte und mit Klugscheisser-Formulierungen aufgemotzte Sätze in die Alltagssprache zurückzuübersetzen. So hatte er in einem Zeitungsartikel einmal diese überdrehte Formulierung gefunden: „Im Hagestolzenheim, das dem Tarifeden einer Luxusdirne ähnelt, neben dem breiten Himmelbett das neuste Buch des just in die Mode gelotsten Sexualmystagogen haben“. Karl Kraus übersetzte das in ein schlichtes: „In seiner eleganten Junggesellenwohnung sich auch geistig beschäftigen.“ Und versäumte nicht, den Leser hilfreich darauf hinzuweisen, dass mit „Tarifeden“ wohl ein „Tarif-Eden“ gemeint sei.
Diese Art von sprachlicher Hochstapelei ist auch heute keineswegs ausgestorben. Vor kurzem las ich in einer Tageszeitung – nicht in einem wissenschaftlichen Artikel, wo Fremdworte und Neologismen gewissermassen der Geheimcode für Insider sind – in einer auch sonst mit ähnlichen Formulierungen gespickten Kolumne diesen schönen Satz: „Kreativität wird vom selbst optimierenden Subjekt der digitalen Spätmoderne als Ressource begriffen, als Mittel zum Zweck.“ Ich brauchte einige Zeit, bis ich mich aus der Deckung herauswagte, in die ich mich vor diesem Fremdwortbombardement geflüchtet hatte, und begriff, dass der Autor hier seine eigene Arbeitsweise beschrieb: Ein krampfhaft kreativer Umgang mit der Sprache als Mittel zum Zweck, die eigene Gedankentiefe zu beweisen. So wie der Kunde eines teuren Modelabels dessen Firmenzeichen zur Schau trägt, damit niemand an seinem exklusiven Geschmack zweifelt.
Nein, Herr Waggerl, ein Fremdwort ist nicht immer ein unscharfes Foto. Manchmal ist es das extrem scharfe Porträt des Hochstaplers, der es verwendet.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 26. Februar 2017,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats Februar
Wann immer du das Bedürfnis hast, etwas besonders Elegantes zu schreiben, tu es von ganzem Herzen – und lösche es wieder, bevor du das Manuskript in Druck gibst. Ermorde deine Lieblinge!
Sir Arthur Quiller-Couch
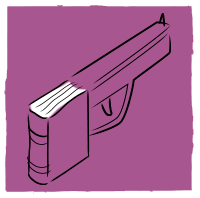
„Kill your darlings“, sagte die Stimme in seinem Kopf. Immer wieder: „Kill your darlings!“
Die Pistole hat er sich bei einem Berufskollegen besorgt, der Kriminalromane schrieb und sich deshalb mit solchen Sachen auskannte. Ihr kaltes Metall fühlte sich in seiner Hand an wie… wie.
„Nein“, sagte er zu sich selber, „keine Metaphern mehr. Nie mehr. Am Schluss muss man sie ja doch nur wieder umbringen. Und das tut einem dann immer so weh.“
Leise und vorsichtig öffnete er die Tür.
Die Metapher räkelte sich reizend auf der Récamiere. (Eigentlich war es ein ganz gewöhnliches Sofa, aber er hatte ihr in der ersten Verliebtheit ein paar Stabreime geschenkt, und sie hatte sich so rührend darüber gefreut, dass er ihr immer wieder neue mitgebracht hatte.) Ihre Finger spielten mit der Kette aus brillant geschliffenen Formulierungen, die er ihr am Tag ihrer Erschaffung um den Hals gelegt hatte. Der Rock ihres schulterfreien Abendkleides war so hoch geschlitzt, dass ihre Beine endlos lang schienen. Der verlockende Anblick wurde nur unwesentlich durch die warnende Schrift gestört, die er bei ihrer letzten Begegnung eigenhändig auf der matt schimmernden Seide angebracht hatte: „Vorsicht, Klischee!“ Ihre blonden Haare umrahmten ein Gesicht von so engelhafter Lieblichkeit, dass man bei ihrem Anblick André Rieu zu hören vermeinte.
Es war höchste Zeit, dass er sie endlich umbrachte.
Er entsicherte die Pistole, und das leise Klicken erinnerte ihn an… an…
Nein.
Auch keine Vergleiche mehr. Am Anfang machten sie einen glücklich, aber schon beim dritten Wiedersehen war die Attraktion verschwunden und man fand sie nur noch widerlich.
„Kill your darlings!“, wiederholte die Stimme in seinem Kopf.
Noch einmal zögerte er. ‚Ich habe sie doch einmal geliebt‘, dachte er, nur um sich gleich selber zu fragen: „Warum eigentlich?“ Und darauf wusste er keine Antwort.
Noch einmal sah er sie an, dann krümmte sich sein Finger über dem Abzug und er killte sie mit knatternder Kugel. Ein letzter Stabreim, das war das Mindeste, das er seinem toten Darling zum Abschied hatte schenken können.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 26. März 2017,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats April
Die Wirklichkeit ist eine miserable Romanautorin, weil sie weder auswählen, noch ordnen, noch dosieren kann; weil sie alle zufälligen Einfälle zulässt, ohne mit der Wimper zu zucken; weil sie sich alle Unwahrscheinlichkeiten weismachen lässt, sogar solche, die uns in einem Roman oder einem Film ausrufen liessen: „Also wirklich! Und das soll ich glauben?“
Javier Marías
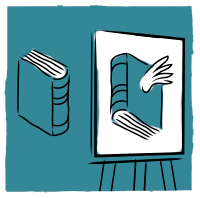
Mit zunehmendem Alter bekommt man von jungen Kollegen immer häufiger Manuskripte vorgelegt, mit der Aufforderung, sich doch bitte kritisch dazu zu äussern. (Sie sagen immer „kritisch“, und meinen immer „lobend“.)
Und wenn man dann ganz vorsichtig anmerkt, das eine oder andere geschilderte Ereignis sei denn doch recht unwahrscheinlich, diese oder jene Koinzidenz allzu unglaubhaft, dann bekommt man regelmässig die immer gleiche Antwort: „Aber es ist wirklich so passiert.“
Ach, wenn es nur so einfach wäre!
Denn was wahr ist, ist in der Literatur noch lang nicht wahrscheinlich, und was wirklich ist, noch lang nicht wirkungsvoll.
Ernest Hemingway hatte völlig Recht, als er sagte: „Allen guten Büchern ist eines gemeinsam: Sie sind wahrer, als wenn sie wirklich passiert wären.“ Gullivers Reise nach Liliput ist wahrer als jeder Bericht vom letzten Sommerurlaub an der asturischen Küste. Auch wenn der Wirt in der Cervecería tatsächlich nur ein Bein hatte und trotzdem nach der dritten Flasche Tempranillo den Flamenco tanzte.
Gähn.
Dass ein Ereignis exakt so abgelaufen ist, wie es jetzt auf dem Papier steht, nichts weggelassen und nichts hinzugefügt ‒ das eignet sich noch lang nicht zum Freipass bei der kritischen Beurteilung. Die Wirklichkeit ist kein Entschuldigungszettel für die Prüfung durch den Leser.
Wahr, liebe junge Kollegen, werden Geschichten erst, wenn wir sie für unser Buch zurechtgelogen haben. So wie wir es ja auch mit unseren Erinnerungen tun, die wir bei jedem Wiedererzählen ein bisschen in Form stutzen und zurechtschleifen, bis sie uns schliesslich selber so real erscheinen, wie es nur kunstvoll gepflegte Erfindungen sein können. Die Wirklichkeit kann da nicht mithalten.
Pablo Picassos Definition gilt auch für unseren Beruf: „Kunst ist die Lüge, die die Wahrheit enthüllt.“
(Natürlich gibt es auch eine Lüge, die das Gegenteil tut und die Wahrheit verhüllt. Man nennt sie Kitsch.)
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 30. April 2017,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats Mai
Aus Langeweile über die Art des Vorlesens gingen die Leute immerfort einzeln weg, mit einem Eifer, als ob nebenan vorgelesen werde.
Franz Kafka

Bis zu diesem Moment war es eine Lesung wie alle andern gewesen. Die Lampe am Lesetisch blendete nicht, ein Glas mit Wasser stand bereit, und im Publikum sassen, wie das eigentlich immer der Fall ist, sehr viel mehr Frauen als Männer.
(Irgendwann einmal wird ein Soziologe ein dickes Buch darüber schreiben, warum Frauen zu Lesungen gehen und Männer zum Fussball. Und ob das auch so ist, wenn Pedro Lenz aus „Der Goalie bin ig“ vorliest.)
Auch ich selber fühlte mich ganz gut in Form, die Zuhörer schienen aufmerksam, und soweit ich sehen konnte war noch niemand eingeschlafen.
(Es schläft bei Lesungen eigentlich fast immer jemand ein. Meistens sind es ältere Männer und nur ganz selten Frauen. Auch das ein Fall für den Soziologen.)
Und dann, mitten in einem Kapitel, stand in der dritten Reihe ein Mann auf und bahnte sich an den Knien seiner Nachbarinnen vorbei einen Weg zum Ausgang. Er tat es, wie mir schien, nicht etwa schüchtern oder verlegen, sondern mit wilder Entschlossenheit, genauso, wie es Franz Kafka geschildert hatte: als ob nebenan vorgelesen werde.
Es wurde nebenan aber nicht vorgelesen. Nebenan war nur die Garderobe.
Und seither überlege ich: Was war da passiert? Hatte ihn seine Frau trotz heftigen Widerstandes zu meiner Lesung geschleppt, und er war pünktlich um acht Uhr einundzwanzig zum Schluss gekommen, sich doch lieber scheiden zu lassen, als mir noch länger zuzuhören? War er von dem Buch, aus dem ich vorlas, enttäuscht, weil darin weder Flip noch Tante Martha vorkam und auch sonst keine Figur aus „Fascht e Familie“? Erinnerte ihn das Timbre meiner Stimme an den Primarlehrer, der ihn damals eine Klasse hatte wiederholen lassen?
Oder, um die Sache positiver zu sehen: War er vielleicht ein berühmter Chirurg, und sein diskret vibrierendes Handy hatte ihm gerade mitgeteilt, das lang erwartete Spenderherz sei nun endlich eingetroffen?
Ich werde es nie erfahren.
Um ein Geständnis abzulegen: Ich bin, vor allem bei Theatervorstellungen, auch schon selber vor dem Ende aus dem Saal verschwunden. Aber ich habe doch immerhin jedes Mal bis zur Pause gewartet. Darum, hihihi, macht man bei Lesungen ja auch keine Pause.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 28. Mai 2017,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats Juni
Das Grauenvolle – das ist das, was zugleich lockt und schreckt.
Henrik Ibsen
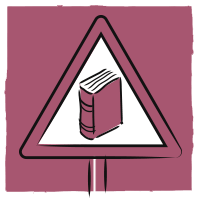
Der amerikanische Komiker Scott Rogowsky hat sich einen interessanten literarischen Spass gemacht: Er versah Bücher mit gefälschten Titelblättern und setzte sich – scheinbar eifrig lesend ‒ mit ihnen in die U-Bahn. Und zwar so, dass seine Mitpassagiere gut erkennen konnten, welche Lektüre ihr Gegenüber da so faszinierte.
Das Ergebnis des Experiments: Rogowsky hatte auch in der wildesten Stosszeit immer eine Menge Platz für sich. Weil niemand einem Mann, der so schreckliche Bücher las, allzu nahe kommen wollte.
Er hatte sich aber auch wirklich hübsch abstossende Titel ausgedacht. „Wie man einen Furz zurückhält“ hiess eines der Bücher, und ein anderes: „101 Penis-Verlängerungs-Übungen für unterwegs“. Auch „Unbestraft Morden für Dummies“ erwies sich als äusserst wirkungsvoll. Mein persönlicher Absurditäts-Favorit war ein Buchumschlag, der Adolf Hitler mit einer fröhlichen roten Gumminase zeigte. Und darüber verkündete ein knallbunter Schriftzug: „‘Mein Kampf‘ für Kinder – mit einem Vorwort von Roald Dahl.“
Ein hübscher Einfall, fürwahr. (Das „fürwahr“ steht hier nur, weil ich schon lang nach einer Gelegenheit suche, dieses so wunderschön altmodische Wort in einen Text einzubauen.) Nur mit ein paar Buchumschlägen verwandelte Scott Rogowsky die U-Bahn zwischen Brooklyn und Times Square in eine literarische Geisterbahn.
Ich meine: Was die Amerikaner können, können wir Schweizer schon lang. Und schlage Ihnen deshalb ein Spiel vor, mit dem sich die sonntägliche Brunch-Runde vergnüglich verlängern lässt. Indem sich nämlich rund um den Tisch jeder die Frage stellt: Mit welchem Buchtitel liessen sich Mitreisende in der SBB oder im Tram am besten schocken?
Wäre es „Warum ich immer Recht habe“ von Roger Köppel? Oder doch eher „Grundkurs für Redner“ von Bundesrat Schneider-Ammann? (Obwohl das als Hörbuch noch mehr Schrecken erregen würde.) Oder vielleicht einfach „Hundert schönste Steuererklärungen?“
Lassen Sie bei Gipfeli und Kaffee Ihrer Phantasie freien Lauf! Sie sind ja nicht verpflichtet, sich mit Ihrem Horrortitel auch wirklich in den Schnellzug nach Bern zu setzen.
Ausserdem: Im Schnellzug nach Bern sitzen meistens Politiker. Und die sind sowieso durch nichts mehr zu schockieren.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 25. Juni 2017,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats Juli
Die Sonne glühte, um eine Zeile zu füllen.
Kurt Tucholsky
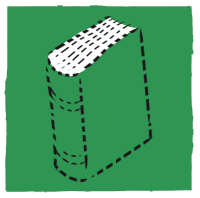
Ach ja, verehrter Meister Tucholsky, ich weiss genau, was Sie meinen. Immer wieder stösst man in Romanen auf Sätze, die man auch Violinensätze nennen könnte, denn sie gehören gestrichen. Und sie würden (das Zitat wird Pearl S. Buck zugeschrieben) eine Lücke hinterlassen, die sie vollkommen ersetzt.
Und doch stehen sie da, und man fragt sich: Warum hat sie der Autor überhaupt hingeschrieben? War es wirklich seine Absicht, uns etwas mitzuteilen, das er nicht so genau weiss, und das wir nicht so genau wissen wollen? Oder ist ihm das Schreiben für einmal so flüssig von der Hand gegangen, dass hinterher auch etliches Überflüssige auf dem Papier stand? Oder war nur sein Lektor gerade in Urlaub?
„Zeilen schinden“ ist ein schöner Ausdruck. Wenn man einem toten Tier – es kann auch der Pegasus sein ‒ die Haut abzieht, dann schindet man es. Und so etwas Ähnliches tut man ja auch, wenn man einem eigentlich schon totgerittenen Gedanken noch eine allerletzte Formulierung aus den Rippen schneidet.
Der Duden führt unter dem Stichwort „schinden“ unter anderem auch diese Bedeutung auf: „Jemanden durch übermässige Beanspruchung seiner Leistungsfähigkeit quälen“. Das gilt auch für Texte. Und für deren Leser.
„Schinden“, kann aber, immer noch laut Duden, auch etwas ganz anderes bedeuten: „Sich mit etwas sehr abmühen.“ Und das, jeder Kollege wird es mir bestätigen, ist eine sehr präzise Beschreibung des Schreiberberufes. Manchmal plagt man sich mit einem Text so sehr ab, dass man vor lauter Dankbarkeit für eine endlich gefundene Formulierung gar nicht merkt, dass das vermeintliche Edelmetall nur Katzengold ist.
Und noch eine dritte Wortbedeutung von „schinden“ meldet der Duden: „Die Bezahlung von etwas umgehen.“ Schriftsteller bezahlen ihre Produkte nicht gerade mit Blut, Schweiss und Tränen, aber lange Arbeitsstunden und Kopfschmerzen werden schon in Rechnung gestellt. Wer sich vor dieser Bezahlung drückt und einfach die nächstbeste Formulierung aus dem Regal klaut, das ist dann eben ein Zeilenschinder.
Übrigens: Die einzig richtigen Verbformen dazu habe ich im Duden seltsamerweise nicht gefunden. Sie müssten so lauten: „Schinden, Schande, Schund“.
PS: Die Redaktion meldet mir eben, dass diese Glosse ein bisschen zu kurz ist. Kein Problem. Es ist Sommer, und die Sonne glüht.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 27. August 2017,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats September
Es gibt keine Teetasse, die gross genug und kein Buch, das lang genug für mich wäre.
C. S. Lewis
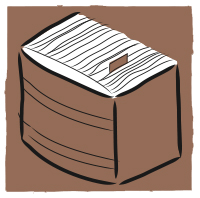
Auch wenn Leser von „Bücher am Sonntag“ selbstverständlich prinzipiell nur anspruchsvolle Bücher geniessen ‒ manchmal packt auch den feinschmeckerischsten Feinschmecker die Gier nach einem Hamburger oder nach einer Riesenportion Pommes. Mit ganz viel Ketchup. Und Mayo. Und ungesund viel Salz.
Manchmal, geben wir es zu, will auch der feinsinnigste Leser einfach ein Kilo Buch verschlingen, von tausend Seiten aufwärts. Mit ganz vielen Charakteren. Und Schicksalen. Und ungesund vielen Abenteuern.
Solche Anfälle treten besonders häufig an verregneten Sonntagnachmittagen auf, sowie an dritten Urlaubstagen, wenn dem Platz am Swimmingpool trotz des bunten Schirmchens auf dem Daiquiri einfach etwas zum vollständigen Feriengenuss fehlt. Nämlich ein Schmöker.
Aber Vorsicht: Nicht jedes dicke Buch qualifiziert sich automatisch für diese Kategorie. Wer den „Mann ohne Eigenschaften“ oder „Ulysses“ so despektierlich bezeichnet, kriegt in jedem Literaturseminar ein paar hinter die Löffel. Die Seitenzahl allein ist noch kein Indiz für Schmökerizität. (Man will ja auch ab und zu ein neues Fachwort erfinden.)
Wie zu einer richtigen Zigarette das Nikotin, so gehört auch zu einem richtigen Schmöker eine gehörige Prise Suchtstoff. So ein Buch muss süchtig machen nach immer neuen Verwicklungen, immer neuen Abenteuern, immer neuen Überraschungen. Zugegeben, mit Literatur hat das wenig zu tun. Aber Konsumenten mit einem akuten Anfall von Schmökersucht stört das überhaupt nicht. Auch wer weiss, dass ein Tofu-Burger viel gesünder wäre, will ab und zu in einen Big Mac beissen.
In Massen genossen (warum hat die Schweizer Rechtschreibung bloss kein Scharf-S?) sind Schmöker auch nicht gesundheitsschädlich. Wie der in solchen Dingen erfahrene Oscar Wilde so richtig sagte: „Versuchungen soll man nachgeben. Wer weiss, wann sie wiederkommen.“
PS. Damit niemand sagen kann, diese Kolumne sei nicht lehrreich, hier noch schnell eine Lektion Etymologie: Ein Schmöker war ursprünglich wirklich einfach ein dickes Buch, dick genug, dass es nicht auffiel, wenn man heimlich eine Seite herausriss, um sich mit ihr als Fidibus seine Pfeife anzuzünden. Die man dann genüsslich schmauchen oder eben smöken konnte. Und damit schon wieder einer Sucht nachgegeben hatte.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 24. September 2017,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats Oktober
Das dauernde, wahllose Besprechen von Büchern ist ein ungewöhnlich undankbarer, lästiger und erschöpfender Beruf.
George Orwell

Ein Buch zu lesen, nur um nachher darüber zu schreiben, das stelle ich mir vor, als ob man eine Frau küsste, nur um darüber zu befinden, ob sie das Spiel mit Lippen und Zunge auch wirklich beherrsche. Als ob man als auf Familienmitglied verkleideter Privatdetektiv an der festlichen Tafel eines Hochzeitstages sässe und nur darauf lauere, den Ehemann bei einem gerichtsverwertbaren Fauxpas zu erwischen. Als ob man im offenen Auto durch eine fremde Landschaft führe, voll auf die Beobachtung konzentriert, ob der Wagen auch gut gefedert sei.
Ein Buch zu lesen, nur um anschliessend über die Lektüre zu berichten, das stelle ich mir vor, wie zwangsweise in einem Schlemmerlokal speisen zu müssen, von täglicher Überfütterung aufgebläht, und bereits beim Studieren der Speisekarte nur zu denken: „Und ich wäre doch so gern auf Diät.“ Wie wenn man bereits gestern in einem Konzert gewesen wäre und vorgestern auch, und jede Aufführung schon zu lang fände, noch bevor der Dirigent auch nur den Taktstock gehoben hat. Wie das Leben einer Stopfgans, der immer neues Lesefutter in den Hals in den Hals gequetscht wird, und sie ist doch längst schon satt.
Ein Buch zu lesen, nur um hinterher Kluges darüber sagen zu können, das stelle ich mir vor wie das Leben eines Galeerensklaven, angekettet an eine Ruderbank aus Neuerscheinungen und vom Trommelschlag des Redaktionsschlusses erbarmungslos angetrieben. Wie das Schicksal eines einsamen Bergmanns, der sich, nur mit Schaufel und Lesebrille bewaffnet, durch dunkle Schächte kämpft, und in all dem Schutt und Geröll die Hoffnung auf eine Goldader für immer aufgegeben hat. Wie die Tragödie eines Märchenprinzen, der sich durch einen Berg aus Haferbrei ins Schlaraffenland zu fressen hofft, aber wie er auch schluckt und würgt, es wird immer neuer Haferbrei nachgeliefert, und den haben die vielen Köche schon lang für ihn verdorben.
Ich stelle mir vor, dass man nachts von dräuenden Gebirgszügen aus bedrucktem Papier träumt, es ist, als ob es tausend Bücher gäbe und hinter tausend Büchern keine Welt.
Rezensenten, stelle ich mir vor, sind Helden.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 22. Oktober 2017,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats Dezember
Wenn ihr einen besonders schönen Sonnenuntergang habt, leg eine Wolldecke drüber und bewahr ihn auf, bis ich da bin.
Mark Twain an seine Tochter
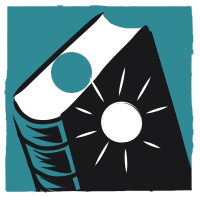
Eine Wolldecke muss es ja vielleicht nicht gerade sein, aber Mark Twain beschreibt mit diesem Sprachbild ganz exakt die Arbeit des Schriftstellers: Einen besonderen Augenblick festhalten, damit man ihn auch noch geniessen kann, wenn er längst vorbei ist.
Die Mistel an dem Baum in jenem Herbst, die genau so aussah wie die antike griechische Maske eines Tragöden – wenn sie nicht beschrieben wird, bleibt nichts von ihr übrig.
Oder wie mein jüngster Enkel mit den Beinchen zappelt, als ob er für einen Marathonlauf trainieren wollte, obwohl er noch nicht mal stehen kann – nur wenn ich den Moment zu Papier bringe, kann ich mir den liebevollen Beschützerdrang, den ich bei diesem Anblick empfand, auch in ein paar Jahren wieder in Erinnerung rufen.
Das Wunderbare an diesen magischen Wolldecken ist, dass sie auch funktionieren, wenn eigentlich gar nichts drunter ist. Was wir damit festhalten, kann auch etwas Ausgedachtes sein. Denn das ist das Seltsame an der Literatur: Erfundene Geschehnisse, erfundene Gefühle können ihre Leser oft stärker erschüttern als jede Wirklichkeit. Sogar wenn dieser Leser der Verfasser selber ist. Wenn ich eigene Romane nach vielen Jahren wieder lese, kommt es immer wieder vor, dass mich eine Szene so berührt, als ob ich beim Schreiben etwas tatsächlich Erlebtes gemeint hätte.
Aber eben: Es muss schon die spezielle Schriftsteller-Wolldecke sein. Irgendein Lappen genügt nicht. Wir haben es alle schon oft erlebt, dass jemand eifrig versuchte, ein Erlebnis aufzuschreiben – und trotzdem blieb nichts davon übrig als eine Ansammlung von Worten.
In Theaterkreisen erzählt man sich die Anekdote von dem jungen Schauspieler, der von der Beerdigung seines Vaters zurückkehrt und noch so von seinen Gefühlen überwältigt ist, dass er den Monolog des Melchthal, in dem der den Tod seines Vaters beschreibt, so innerlich bewegt spricht, wie er es noch nie geschafft hat. Worauf ein älterer Kollege zu ihm sagt: „Nur weil du ein bisschen Erfolg gehabt hast, darfst du jetzt nicht anfangen zu schmieren.“
Auch der schönste Sonnenuntergang kann in der Beschreibung kitschig werden. Außer man verfügt über jene magische Wolldecke, die sich Mark Twain erträumte.
Rezensenten, stelle ich mir vor, sind Helden.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 10. Dezember 2017,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«

