Glosse des Monats Januar 2013
Der Kunstgriff täuscht mich nicht: / Du gibst dich strafbar, um dich rein zu waschen.
Friedrich Schiller

Mea culpa. Mea maxima culpa. Ich habe gesündigt, ich habe gefrevelt, ich habe mich vergangen gegen die Gesetze des Universums. Schon höre ich von allen Seiten das hämische Sabbern der Erinnyen, die mit gereckten Krallen darauf lauern, mich in die Unterwelt zu schleifen. Und zwar nicht in irgendeine Unterwelt, sondern in jenen allertiefsten, grässlichsten Kreis des Infernos, von dem nicht einmal Dante etwas wusste, in die höllischsten aller höllischen Gefilde, wo man jeden Tag dasselbe Buch lesen muss, und das heisst grausamer Weise „Shades Of Grey“.
Und – mea culpa, mea maxima culpa – ich habe diese Strafe verdient. Denn ich habe das Verbrechen begangen, für das es keine Gnade geben kann: Ich habe Bücher weg¬geworfen. Und zwar nicht eines oder zwei, sondern gleich mehrere Stapel. Einfach in die Kehrrichtverbrennung gekarrt, und dort… Ich schaudere jedes Mal, wenn ich daran denke. Ich bin ja kein völlig gefühlloses Monster.
Ich habe versucht, wirklich, den Büchern dieses Schicksal zu ersparen. Ich habe es wieder und wieder versucht, das schwöre ich bei allen Göttern meines literarischen Firmaments, bei Flaubert und Tucholsky und Ed McBain. Ich habe versucht, ihnen eine neue Heimat zu verschaffen, habe bei vielen Antiquariaten angerufen und bei noch mehr Brockenhäusern. Und alle, al-le, die ich anfragte, lachten nur bitter. „Bücher?“, sagten sie. „Bücher will doch keiner mehr haben. Diese Zeit ist vorbei“, sagten sie. „Bücher kann man nicht mehr verschenken und schon gar nicht verkaufen. Bücher kann man nur noch entsorgen.“
Ich weiss, hohes Gericht, das sind keine mildernden Umstände. Ich flehe ja auch nur um ein bisschen Verständnis, bevor das endgültige und unausweichliche Urteil gesprochen wird. Ich will ja nur erklären, wie es dazu gekommen ist.
All die Bände hatten keinen Platz mehr bei mir, denn ich bin von der unheilbaren Seuche des Bücherkaufes befallen und schaffe ständig wieder neue an. Aber Regale – ich bitte das zu meiner Entlastung zu Protokoll zu nehmen – sind nun mal endlich, und das Neuere ist der Feind des Alten. Wobei ich natürlich, beeile ich mich hinzuzufügen, keine Klassiker weggeschmissen habe. So ver-kommen bin nicht einmal ich.
Aber die unverzeihliche Schandtat habe ich begangen. Ihren Makel wird keine Reue je wieder von mir nehmen. Ich habe Bücher weggeworfen. Mea culpa. Mea maxima culpa.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 27.Januar 2013,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats Februar 2013
Ich war schon als kleiner Junge ein Lügner. Das kam vom Lesen.
Isaak Babel
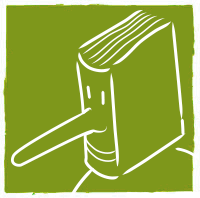
„Alle Autoren sind Lügner“, sagt ein chinesisches Sprichwort. (Und fügt, gegen alle fernöstliche Höflichkeit hinzu: „Alle Leser sind Idioten, weil sie die Lügen glauben.“) Der Satz hat was. (Nur der erste Teil natürlich.) Ein Buch zu schreiben ist eine der wenigen gesellschaftlich akzeptierten Arten, die Unwahrheit zu sagen.
Zugegeben, es gibt auch andere Berufe, bei denen der ökonomische Umgang mit der Wahrheit zum professionellen Alltag gehört. Politiker, zum Beispiel, oder Werbeleute. Aber die dürfen den mangelnden Wirklichkeitsbezug ihrer Aussagen nicht offen zugeben, sondern müssen im Brustton der Überzeugung behaupten, immer nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu sagen. Weil sie sonst nämlich Gefahr laufen, ihr Amt zu verlieren. Oder, noch viel schlimmer, ihren Account.
Wir Schreiberlinge hingegen… Wir dürfen von Heldentaten erzählen, die nie stattgefunden haben, dürfen uns Liebesgeschichten mit bonbonrosafarbigen Happyends ausdenken, dürfen unsere Protagonisten Schlachten schlagen lassen, in denen wir ganz allein über Sieger und Verlierer entscheiden. Wir dürfen alles. Manchmal bekommen wir sogar Preise dafür.
Und der Leser, dieser nette Mensch, ist stets bereit, uns unsere Lügen zu glauben. Nicht etwa, weil er ein Idiot ist – Schande über den unhöflichen chinesischen Sprichworterfinder! –, sondern weil er weiss, dass die sonst so gut bewachte Grenze zwischen Wahrheit und Erfindung in einem Buch durchlässig wird. Und weil die literarische Lüge manchmal viel wahrer sein kann als die Wirklichkeit, die sie zu beschreiben vorgibt.
Einmal, ich erinnere mich gern daran, ist mir so ein perfektes Täuschungsmanöver gelungen. Als ein Kritiker „Melnitz“ rezensierte und meinte, manche der Figuren, die darin vorkämen, müssten wohl ein reales Vorbild haben. Weil man nämlich, schrieb er, so lebendige Charaktere nicht erfinden könne. Für den schreibenden Berufslügner ist so eine Bemerkung schon fast der Münchhausen-Pokal.
Ja, wir dürfen rund um die Uhr nach Herzenslust lügen und schummeln. Und nur schon deshalb ist das Schreiberleben auch immer ein reines Vergnügen und hat mit wirklicher Arbeit überhaupt nichts zu tun.
(Was eben, falls Sie es nicht gemerkt haben sollten, auch schon wieder gelogen war.)
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 24.Februar 2013,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats März 2013
Für das Schreiben eines Romans gibt es drei Regeln. Leider kennt sie niemand.
W. Somerset Maugham
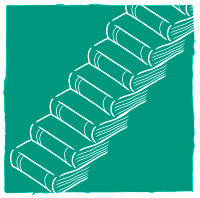
In den Kursen, in denen man das Schreiben lernt… Nein: In den Kursen, für die sich die Leute anmelden, weil sie meinen, sie würden dort zu Schriftstellern gemacht, bekommt man auf die Frage nach der Motivation der Studenten von manchen die Antwort: „Ich will hier lernen, wie man schreibt, und wenn ich es dann gelernt habe, werde ich schreiben.“ Und man weiss: So sehr sie sich auch anstrengen, so viele Handbücher der Romankonstruktion sie auch studieren – das sind keine richtigen Schreiber. Sie könnten mit einem anderen Hobby bestimmt glücklicher werden. Den Eiffelturm aus Streichhölzern zusammenkleben, zum Beispiel. Das soll sehr vergnüglich sein, höre ich.
Bei den richtigen Schreibern kommt man meist gar nicht dazu, die Frage zu stellen. Weil sie einen schon unter der Tür abfangen und einem erklären, sie hätten da, ganz zufällig, ein eigenes Manuskript in der Tasche, und ob man nicht so nett sein wolle, das bis morgen mal durchzulesen. Es seien auch nur bescheidene fünfhundert Seiten.
Man weiss dann noch nicht, ob aus diesem Mann mal ein guter Autor oder aus dieser Frau mal eine gute Schriftstellerin werden kann, aber man weiss: Die sind am richtigen Ort. Denn in diesem Gewerbe gilt nur eine einzige Definition.
Ich bitte um Verzeihung, wenn ich sie auf Englisch hinschreibe, aber so perfekt kann man es auf Deutsch nicht formulieren: A writer is someone who writes. Punkt, aus, Ende der Durchsage. Alles andere ist Kommentar und Fussnote.
Ich weiss nicht, ob es an den Genen liegt, ob irgendwann eine Muse ins Kinderzimmer geflattert kommt und dem zum Schriftsteller bestimmten Säugling einen Kuss appliziert, oder ob ein Virus die Schuld trägt. Ich weiss nur, dass ich noch nie einen Schreiber getroffen habe, der nicht bei jeder Gelegenheit geschrieben hat. Oder, wenn er gerade unter Schreibstau litt oder von der Angst vor dem leeren Bildschirm geschüttelt wurde, zumindest wusste, dass er eigentlich hätte schreiben sollen.
Wer nicht von diesem Virus befallen ist, bei wem das Kinderzimmerfenster keine Musenklappe hatte, wer nicht unter diesem seltsamen Gendefekt leidet, dem können auch hundert Semester Creative Writing nicht weiterhelfen.
Um noch einmal Somerset Maugham zu zitieren: „Wir schreiben nicht, weil wir wollen. Wir schreiben, weil wir müssen.“
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 31. März 2013,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats April 2013
…unbearbeitet, eine rohe Tonmasse, voller Kehricht, mit Baugerüsten, herumliegendem Werkzeug und allerlei Gerümpel.
Iwan Gontscharow über einen unfertigen Text
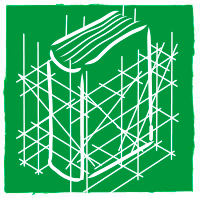
Wer zum Teufel hat wieder diese Adjektive herumliegen lassen? Muss denn ums Verrecken der nächste Unfall passieren? Erst letzte Woche ist einer über ein vergessenes „nachhaltig“ gestolpert und hat sich die Grammatik gebrochen. Und die Versicherung hat sich geweigert, auch nur einen Rappen zu bezahlen. Weil „nachhaltig“ überhaupt kein Wort sei, sondern nur ein modisches Klischee.
Und wenn ihr dabei seid: Räumt auch gleich den Haufen mit den „und“ weg, gopfertellisiech! Wofür hängen denn überall diese Plakate? „Zuviel und ist ungesund!“ Merkt euch das endlich! Sonst hol ich mir meine nächsten Schreiber aus einem Billiglohnland! So ein Trupp Inder schraubt euch eine Trilogie im Akkord zusammen, da könnt ihr dann sehen, wo ihr bleibt!
Wie bitte? Was hast du? Einen Bachelor in „Creative Writing“? Jöö! Bist du nicht der Typ, der gestern einen Nebensatz ohne Sicherheitsabsperrung hat in der Luft hängen lassen? Und dann behauptet, das sei kein Fehler sondern Stil? Nicht nur, dass das lebensgefährlich war – die ganze Baustelle ist stillgestanden, wegen diesem Seich! Weil alle auf das Verb gewartet haben, das du vergessen hast. Wir machen hier nicht Kunst, merk dir das, wir machen einen Roman! Meinst du, der Generalunternehmer will den Erscheinungstermin verschieben, bloß weil der Herr Bachelor jedes Mal erst ein Synonym suchen muss, bevor er ein Substantiv festschraubt?
Und wer, huerecheibeschiissdräck, hat diese beiden Kapitel aneinander montiert! Ja, die beiden, mit dem Zeitsprung dazwischen, so gross dass sich jeder Leser das Kontinuum verrenkt! Soll sich melden, der Dilettant! Natürlich, jetzt will es wieder keiner gewesen sein! Aber „Ghostwriter“ kommt von “Geist“, nicht von „Pfusch“, merkt euch das endlich!
Also, Leute, nehmt euch ein bisschen zusammen! Sonst muss ich dann andere Seiten aufziehen!
Ihr seid ja wirklich die letzten Säcke! Nicht einer hat gemerkt, dass das soeben ein brillantes Wortspiel war! Seiten statt Saiten. Von wegen Bücher.
Aber so was kriegt ihr ja überhaupt nicht mit! Sucht euch doch einen Hilfsarbeiterjob bei einem Ärzteroman! Für die echte Literatur seid ihr alle überhaupt nicht zu gebrauchen!
Und es soll mal sofort einer die viel zu vielen Ausrufezeichen wegräumen, die in diesem Text herumliegen! Ich weiss auch nicht, wo die alle herkommen.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 28. April 2013,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats Mai 2013
– Ich habe meinen ganzen Tag mit einem verdammten Sonett verschwendet, ohne einen Schritt weiterzukommen. Und dabei fehlt es mir nicht an Ideen. Ich bin voll davon. Ich habe zu viele.
– Aber, Degas, man macht Verse nicht aus Ideen. Man macht sie aus Worten.
Ein Gespräch zwischen Edgar Degas und Stéphane Mallarmé
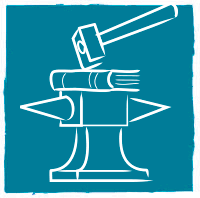
Immer mal wieder liest man ein Buch, dessen Autor so viel zu sagen hat, dass er vor lauter Mitteilungseifer nie dazu gekommen ist, es auch verständlich zu formulieren. Vor lauter Betroffenheit hat er die richtigen Tasten seines Computers nicht mehr getroffen. Die Gewichtigkeit seiner Botschaft hat ihm die Grammatik durchgeschüttelt und den Satzbau durcheinander gebracht. Die Gedanken, an denen ihm so viel liegt, laufen kreuz und quer in alle Richtungen. Und kommen nie beim Leser an.
Ich muss bei solchen Büchern immer an einen Koch denken, der das Servieren nicht erwarten kann und deshalb alle Zutaten der geplanten Mahlzeit in einen grossen Eimer schüttet und den – Friss oder stirb! – vor seinen Gästen auf den Tisch klatscht. So ungeordnet kippen solche Bücher ihre Überzeugungen und Meinungen über den Leser aus, dass man am liebsten einen Schirm aufspannen möchte, um sich vor dem Wortgewitter zu schützen. „Lies mich! Lies mich! Ich bin wichtig!“, schreien sie, und sie tun es so laut, dass man sich gegen den Lärm nur wehren kann, indem man sie ganz schnell zuklappt und auf den Brockenhausstapel bugsiert. Buchdeckel drauf.
Die Literaturkritik hat kein Fachwort für diese Art von Überdruck-Literatur. Man muss sich die richtige Bezeichnung aus der Theatersprache borgen, wo solche Text-Eruptionen als „Schwampf“ bezeichnet werden. (Die Legende berichtet von einem jungen Schauspieler, dessen allererste Bühnenrolle nur aus dem Satz „Schwarz war der Himmel von der Schiffe Dampf“ bestand. Als er dann endlich an der Premiere auf der Bühne stand, drückten ihm Erfolgsgier und Lampenfieber so sehr auf die Stimmbänder, dass er nur noch die Silbe „Schwampf“ hervorbrachte.)
„Mir fehlen die Worte“ sagt man, wenn einen ein Ereignis oder ein Gefühl überwältigt hat. Die Konsequenz daraus müsste eigentlich Schweigen sein. Bei Schwampf-Literaten leider nicht. Sie bringen die Worte, die ihnen fehlen, erbarmungslos zu Papier. Im Irrglauben, das Chaos ihrer Formulierungen würde die Aussage, die ihnen so wichtig ist, authentischer machen. Aber alles, was beim Leser ankommt, ist ein authentisches Durcheinander.
Weil man Bücher, genau wie Sonette, eben nicht aus Ideen macht, sondern aus Worten.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 25. März 2013,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats Juni 2013
– Der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem beinahe richtigen ist derselbe Unterschied wie zwischen einem Blitz und einem Glühwürmchen.
Mark Twain
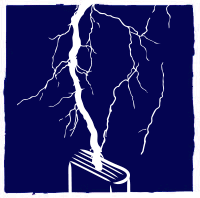
Jeder Autor kennt die Situation: Man weiss ganz genau, was man sagen will, aber man findet einfach nicht das exakt richtige Wort dafür. Die einen kaufen sich dann das Grimmsche Wörterbuch, die anderen machen es so wie ich und stöbern im Internet. Wo man dann meistens auf ganz andere Dinge stösst als man gesucht hat.
Wie zum Beispiel auf eine Liste von Wörtern, von denen der Listenaufsteller behauptet, dass sie nur in einer Sprache existieren und in allen anderen vollständig fehlen. Obwohl sie doch Dinge bezeichnen, die dringend (oder, zugegeben, auch weniger dringend) formuliert werden müssen.
Da ist zum Beispiel der äusserst nützliche japanische Begriff Age-otori, mit der Bedeutung Nach dem Besuch beim Friseur schlimmer aussehen als vorher. Wer hat noch nie beim Blick in den Spiegel nach genau dieser prägnanten Formulierung gesucht?
Und wie haben wir bloss ohne das bei einem kleinen Völkerstamm auf Tierra del Fuego übliche Wort Mamihlapinatapai gelebt? Es bezeichnet den Blickwechsel zwischen zwei Menschen, in dem sich eine unausgesprochene gegenseitige Begierde ausdrückt. Ein äusserst nützliches Wort, scheint mir, nur schon wegen seiner Länge. Bis man Mamihlapinatapai zu Ende gesagt hat, ist die Begierde wahrscheinlich schon längst wieder verflogen und man gerät nicht in Gefahr, Dummheiten zu machen.
Sehr viel alltagstauglicher ist da ein Wort von der Osterinsel. Kurz und bündig fasst es ein Verhalten zusammen, das auch bei uns schon manche nachbarschaftliche Beziehung vergiftet hat. Tingo heisst das Wort und bedeutet: Von seinem Nachbarn einen Gegenstand nach dem anderen ausleihen, bis in dessen Haus nichts mehr übrig ist. Für die meisten Menschen weniger täglich verwendbar dürfte das gälische Sgriob sein, dessen Definition lautet: Das Jucken an der Oberlippe bevor man den ersten Schluck Whisky nimmt. Ich muss gestehen, dass ich dieses Jucken selber noch nie empfunden habe, aber ich trinke auch Bourbon, und das authentische Sgriob stellt sich wahrscheinlich nur bei Single Malts ein.
Auch drei deutsche Worte, für die es in anderen Sprachen keine Entsprechung gäbe, fand ich auf der Liste. Sie lauteten: Waldeinsamkeit, Schadenfreude und Backpfeifengesicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das über uns aussagt.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 30. Juni 2013,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats Juli/August 2013
Was ist ein Name? Was uns Rose heisst, Wie es auch hiesse, würde lieblich duften.
William Shakespeare
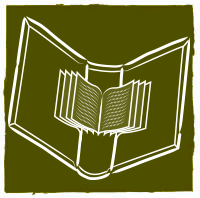
Da hat also Joanne K. Rowling, die Königin aller Bestsellerlisten, einen Krimi geschrieben, und davon wurden im ersten Vierteljahr gerade mal 1500 Exemplare verkauft, Weniger als nichts für jemanden, von dessen Harry-Potter-Romanen fast eine halbe Milliarde Exemplare über die weltweiten Ladentische gingen.
„The Cuckoo’s Calling“ heisst das Buch, und Frau Rowling hat sich damit ganz bewusst selber ein Kuckucksei ins Nest gelegt. Sie liess den Roman nämlich nicht unter dem umsatzbefördernden eigenen Namen erscheinen, sondern unter dem Pseudonym Robert Galbraith. Und für Herrn Galbraith interessierten sich weder Literaturkritiker noch Bücherkäufer.
Bis dann durchsickerte (oder wäre die korrekte Verbform „durchgesickert wurde“?), wer sich hinter diesem unbekannten Mr. Galbraith verbarg. Worauf der Krimi sofort in den Bestsellerlisten landete. Für die deutsche Übersetzung wird eine Startauflage von 200.000 Exemplaren angekündigt.
Was bewegt eine erfolgreiche Autorin dazu, auf den Startvorteil ihres bekannten Namens zu verzichten und sich gewissermassen ohne Kopfschutz und Ellbogenschoner ins Getümmel des heiss umkämpften Büchermarktes zu stürzen? Wer sich mit hartem Training in die Weltspitze der Langstreckenläufer vorgearbeitet hat, startet beim New Yorker Marathon ja auch nicht freiwillig aus der achtundzwanzigsten Reihe.
Warum also? In den Potter-Romanen wird der Bösewicht aller Bösewichte immer mit „Jener, dessen Name nicht genannt werden darf“ bezeichnet. Aber damit wird es wohl nichts zu tun haben.
Ich vermute, dass hinter der scheinbaren Bescheidenheit eines unbekannten Namens in Wirklichkeit eine gehörige Portion Eitelkeit steckt. Vielleicht wollte sich Frau Rowling beweisen, dass sie es auch unter anderem Namen schaffen würde, einen Bestseller zu landen. Wie wenn Usain Bolt die Behauptung aufstellte: „Ihr könnt mir auch einen Mehlsack auf den Rücken binden, und ich laufe die hundert Meter immer noch schneller als ihr!“
Wenn es so war, hat es nicht geklappt. Zu Harry-Potter-Zeiten hat sie wahrscheinlich 1500 Exemplare als Leseexemplare an die Buchhandlungen der Fiji-Inseln verschickt.
Übrigens: Wenn Sie Ihren Namen nicht mehr brauchen, verehrte Mrs. Rowling, würden Sie ihn mir dann vielleicht für mein nächstes Buch ausleihen? Ich bin sicher, er wäre dem Umsatz sehr förderlich.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 25. August 2013,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats September 2013
Die Leute streiten im Allgemeinen nur deshalb, weil sie nicht diskutieren können.
Gilbert Keith Chesterton

Der Suhrkampf-Verlag…
Ich weiss, ich weiss, er schreibt sich nicht so, aber das falsche Schluss-F rutscht einem einfach in die Tastatur, wenn man an die permanenten internen Querelen denkt. Suhrkamp also, jener legendäre Verlag, den Siegfried Unseld einst gründete, macht seit einiger Zeit mehr Schlagzeilen im Wirtschaftsteil als in den Literaturbeilagen. Statt der Buchkritik wird sich wohl irgendwann nur noch die Kriegsberichtserstattung damit befassen.
Ich will in den innerverlaglichen Grabenkämpfen keine Partei ergreifen. Ich wundere mich nur, warum von all den berühmten und musengeküssten Suhrkamp-Autoren bis jetzt noch keiner einen Roman über die hauseigenen Titanenkämpfe geschrieben hat. Pamphlete sind erschienen, ja, und pathetische Aufrufe auch. Aber wo bleibt der grosse Roman?
Dabei bietet das Thema doch jede Menge Stoff! Hans Barlach wahlweise als Herostrat oder Michael Kohlhaas, Ulla Berkéwicz je nach Standpunkt als Jeanne d’Arc oder Megäre, dazu noch der verstossene Sohn Joachim Unseld als Parricida – wenn das nicht Material genug für ein paar hundert Seiten ist…
„Ich wundere mich“, habe ich geschrieben, aber es müsste heissen: „Ich wunderte mich“. Denn unterdessen habe ich im Suhrkamp-Katalog geblättert und dabei festgestellt: Den Roman gibt es. Es gibt ihn sogar mehrfach. Denn durch die richtige Brille betrachtet sieht eigentlich jeder Suhrkamp-Titel danach aus.
Was kann Ivo Andrics „Der verdammte Hof“ anderes sein als ein Bericht über die Kämpfe um das Erbe des Patriarchen Unseld? Wenn Isaiah Berlin ein Buch „Der Igel und der Fuchs“ nennt – wen kann er damit meinen als Frau Berkéwicz und Herrn Barlach? Und was ausser der immer schlechter werdenden Beziehung zwischen den beiden kann mit Elisabeth Bronfens „Liebestod und femme fatale“ gemeint sein? Selbst Dichter, die schon längst tot waren, als der Rosenkrieg im Hause Suhrkamp begann, haben – prophetisch, wie wahre Suhrkamp-Autoren das nun mal sind – über das Thema geschrieben. Denn selbstverständlich bezieht sich Emily Brontës „Sturmhöhe“ auf Ulla Berkéwiczs Berliner Villa mit ihren unkorrekt an den Verlag vermieteten Räumen.
Und so weiter, und so weiter. Wir sind erst beim Buchstaben B. Ich empfehle allen Lesern dieser Rubrik das Spiel selber weiter zu führen. Man braucht dazu nichts als den Suhrkamp-Katalog und ein bisschen Phantasie.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 29. September 2013,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats Oktober 2013
Wozu sind wir denn da, ausser um unseren Nachbarn als Zielscheibe zu dienen und unsererseits über sie zu spotten?
Jane Austen

Meine Bibliothek ist alphabetisch nach Autoren geordnet, was zu seltsamen Begegnungen führt. Manchmal vergnüge ich mich damit, mir zu überlegen, worüber sich solche Zufallsnachbarn wohl unterhalten.
Karl und Groucho Marx, nehme ich an, streiten sich darüber, wessen Form von Marxismus die Menschheit auf Dauer mehr überzeugen werde. (Ich tippe auf Groucho.) Heinrich und Thomas Mann zeigen sich die kalte Schulter. Die beiden Brüder haben sich im Leben nie gemocht, warum sollten sie es in meinem Bücherregal tun? Während sich Joseph Roth und Philip Roth immer nachts, wenn die anderen Bücher schlafen, jüdische Witze erzählen. Die des Amerikaners sind die unanständigeren.
Casanova ist, den Buchstabier-Regeln folgend, neben Cervantes geraten, und versucht ihn von einer Neufassung seines Meisterwerks zu überzeugen, in der Don Quijote seine Dulcinea gleich im ersten Kapitel erfolgreich verführt. Und Mao, eingeklemmt zwischen Hilary Mantel und Gabriel García Márquez, beschwert sich darüber, dass er überhaupt nicht in dieses Regalquartier gehöre. Obwohl… Was phantastischen Realismus anbelangt, könnte er den beiden bestimmt eine Menge Ratschläge geben.
Sigmund Freud und Egon Friedell plaudern natürlich über Wien, während sich Oscar Wilde und Billy Wilder über die Pointen des andern totlachen würden, wenn sie nicht beide schon tot wären. Walter Kempowski leidet, weil er zwischen Friederike Kempner und Alfred Kerr eingeklemmt ist, und die beiden sich permanent über ihn hinweg kabbeln. Kerr ist sauer, weil man den „schlesischen Schwan“ immer für seine Tante gehalten hat, und die Kempner antwortet auf seine Vorwürfe in so ungelenken Reimen, dass einem davon der Schutzumschlag gelb werden kann.
Einmal ergab sich beim alphabetischen Einsortieren eine fast magische Nachbarschaft. Da standen nämlich plötzlich zwei Bücher mit dem exakt gleichen Titel nebeneinander. Eines stammte von Dostojewski und das andere von Dürrenmatt. Und das Unheimliche an der Sache: Beide Bücher hiessen „Der Doppelgänger“.
Unterdessen sind sie keine Nachbarn mehr. Sir Arthur Conan Doyle hat sich zwischen sie geschoben. Und ärgert sich wahrscheinlich darüber, dass ihm dieser Titel nicht auch eingefallen ist. „Das Geheimnis des Doppelgängers“ – das wäre doch etwas für Sherlock Holmes gewesen.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 27. Oktober 2013,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats November 2013
Literature is news that STAYS news.
Ezra Pound

Wussten Sie, dass „Sense And Sensibility“ von Joanna Trollope stammt? Dass Alexander McCall Smith der Autor von „Emma“ ist? Das wussten Sie nicht? Dann sind Sie nicht auf der Höhe des zeitgenössischen Literaturbetriebs. Und wenn Sie jetzt auch noch einwenden, das seien doch zwei klassische Romane von Jane Austen, dann sind Sie, sorry, nachgerade altmodisch.
Ein englischer Verleger ist nämlich auf den Gedanken gekommen, alle Romane von Jane Austen neu schreiben zu lassen. Aktualisiert und ins 21. Jahrhundert verlegt. Damit auch heutige Leser endlich etwas mit den Geschichten anfangen können. Man kann, so seine Überlegung, von den Vertretern der YouTube-Generation nicht erwarten, dass sie sich ins Seelenleben von Figuren des frühen neunzehnten Jahrhunderts einfühlen. Mit anderen Worten: Er hält moderne Leser für blöd.
Ausgerechnet „Sense And Sensibility“, zu Deutsch: „Verstand und Vernunft“! Wo es diesem Projekt doch an beidem fehlt. Das Ganze ausgeheckt von einem Mann, der von Beruf Verleger ist – eine Berufsbezeichnung, die in seinem Fall wahrscheinlich daher stammt, dass er seinen literarischen Geschmack verlegt und nie wieder gefunden hat.
Es ist ihm, das hat mich an der Ankündigung am meisten überrascht, auch tatsächlich gelungen, namhafte Autoren für diesen Akt literarischer Leichenschändung zu gewinnen. Sie müssen alle, so scheint mir, das Zehnfingersystem blind beherrschen. Man sieht ja die Tastatur nicht, wenn man den Blick beim Schreiben die ganze Zeit stur auf die Kasse gerichtet hat.
Es steht zu befürchten, dass die Umsatzzahlen zufriedenstellend ausfallen. Auch chemisch zusammengemixte Lebensmittel-Imitate mit „naturähnlichen Aromen“ verkaufen sich schliesslich gut. Und weil, im Gegensatz zum Sprichwort, das Schlechtere stets der Feind des Guten ist, werden wir bald neuverfasste deutsche Klassiker in den Schaufenstern der Buchhandlungen sehen. Da wird dann der junge Werther seine Lotte bei einem Internet-Dating-Dienst kennenlernen, und Annebäbi Jowäger ihre Familie mit homöopathischen Kügelchen traktieren. Wenn Jane Austen nicht sicher ist, ist niemand mehr sicher,
Mark Twain mochte Jane Austen nicht. Er erklärte einmal, jede Bibliothek, die keines ihrer Bücher enthalte, sei nur schon deshalb eine gute Bibliothek. Aber dieses Schicksal hätte nicht einmal er ihr gewünscht.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 24. November 2013,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«

