Glosse des Monats März 2012
Ein Schriftsteller, der nicht mit dem Bus fährt, weiss nicht mehr, wie die Leute reden.
Harold Pinter

Es gibt zwei Gruppen von Menschen, die neue Worte entwickeln. Einerseits besonders gescheite – oder sich besonders gescheit fühlende – Akademiker, die felsenfest davon überzeugt sind, ihre Gedanken seien auf so einmalige Weise bedeutungsvoll, dass das bestehende Vokabular nicht ausreiche, um sie wirklich exakt auszudrücken. Was dann meistens nur, wie Kurt Tucholsky das schon vor achtzig Jahren in der „Weltbühne“ formulierte, zum „Missbrauch einer zu diesem Zweck erfundenen Terminologie“ führt.
Die anderen Worterfinder sind junge Leute. Für sie ist Sprache ganz selbstverständlich etwas Plastisches, das man jederzeit nach Lust und Laune spielerisch verändern kann.
(Natürlich betätigen sich auch Werbeleute gern sprachschöpferisch. Aber das bestätigt meine These nur. Werber vereinen die beiden Gruppen in sich. Sie sind kindliche Wesen, die sich und ihren Kunden einreden, sie betrieben eine exakte Wissenschaft.)
Nein, die wahren Spracherfinder sind Teenager. Ob ein Wort im Duden steht, oder eine grammatikalische Konstruktion von irgendwelchen beamteten Oberlehrern als korrekt anerkannt wird, das ist ihnen total…
Total was? Ich habe keine Ahnung, welches Synonym man in dieser Generation gerade für „egal, gleichgültig, am Arsch vorbei gehend“ benutzt. Ich weiss nur: Bis ein Wort bis zu mir altem Sack durchgedrungen ist (und das Altsacktum, so scheint mir, beginnt immer früher), ist es bei seinen Erfindern bestimmt schon längst wieder aus der Mode gekommen.
Es gibt ein paar wenige Autoren, die über das beneidenswerte absolute Gehör für aktuelle Sprachformen verfügen. Die sich einfach in den Bus setzen und beim Belauschen fremder Handy-Plaudereien die Sprache der Gegenwart akzentfrei erlernen können. Die meisten von uns sind für alle Zeiten in der Formulierungsweise gefangen, die wir in der eigenen Jugend gebraucht oder selber erfunden haben. Wenn wir versuchen, so zu reden, wie wir es naiver Weise für heutig halten, ernten wir zu Recht nur mitleidige Blicke.
Eigentlich ist das ja auch kein Problem. Ausser wenn wir in unseren Texten versuchen, die Sprache junger Menschen nachzuahmen. Dann machen wir uns rettungslos lächerlich.
Oder, wie die Teenager in diesem Jahr statt „lächerlich“ sagen…
Ich muss zugeben: Ich habe keine Ahnung, wie sie es sagen.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 25. März 2012,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats April 2012
Wenn wir alt werden, so beginnen wir zu disputieren, wollen klug sein, und doch sind wir die größten Narren.
Martin Luther
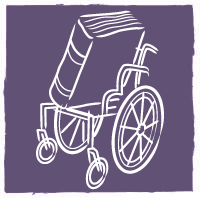
Man müsste, vielleicht von Pro Litteris und Pro Senectute gemeinsam organisiert, einen Dienst zur Betreuung alternder Dichter einrichten, die unter dem Verblassen ihres Ruhms leiden und es schlecht ertragen, nicht mehr im Zentrum des Weltinteresses zu stehen. Das Bedürfnis nach einem solchen Pflegedienst steht ausser Frage, denn der allmähliche Bedeutungsverlust gehört (vor allem bei Nobelpreisträgern) zu den schmerzhaftesten literarischen Altersbeschwerden und wird von den Betroffenen noch unangenehmer empfunden als Zahnausfall und Rheuma.
Aber auch für die Mitmenschen kann dieses geriatrische Problem sehr negative Auswirkungen haben. Die davon Befallenen neigen nämlich zu Rechthaberei, Logorrhoe und unkontrolliertem Verfassen von Leserbriefen, die von ihnen in besonders akuten Fällen als Gedichte wahrgenommen werden.
Die Betreuung, als eine Art Literaten-Spitex organisiert, müsste sich bei ihren regelmässigen Besuchen in der Dichterklause darauf konzentrieren, dem in die Jahre gekommenen Schriftsteller das Gefühl zu geben, er sei keineswegs vergessen, und seine einst erfolgreichen Werke, auch wenn deren Erscheinungsdatum Jahrzehnte zurück liegt, würden in den Feuilletonspalten der Zeitungen und den Literaturseminaren der Universitäten nach wie vor täglich diskutiert. Es bestehe also, dies die subtil zu vermittelnde Botschaft, keinerlei Notwendigkeit, sich durch unbedachte neue Publikationen selber ins Scheinwerferlicht drängen zu wollen.
In besonders schweren Fällen, da wo die Gefahr besteht, dass der alte Dichter sein eigenes Image durch zwanghaftes Leserbrief-Schreiben nachhaltig beschädigt, dürften die Betreuer auch zu kleinen Tricks greifen: So könnten sie sich etwa als Journalisten ausgeben, die zu aktuellen politischen Fragen nach einem Statement des verehrten Meisters gieren, oder als Verehrerinnen, die für ein Autogramm alles, aber auch wirklich alles zu tun bereit sind.
Was eben im Interesse des von Geltungssucht befallenen Greises notwendig ist, um ihn vom Verfassen sogenannter Gedichte abzuhalten.
PS: Mit Günter Grass und seiner Stellungnahme zum iranisch-israelischen Konflikt hat dieser Vorschlag natürlich nichts zu tun.
Überhaupt nichts.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 29.April 2012,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats Mai 2012
Leute, die schreiben können, heissen Schriftsteller. Leute, die nicht schreiben können, heissen ebenso.
Oscar Blumenthal

Irgendwann beschloss der Nationalrat, dass sich nicht mehr jeder Schriftsteller nennen dürfe – wo kämen wir denn da hin? –, sondern dass diesen Titel ab sofort nur noch führen dürfe, wer eine entsprechende Prüfung abgelegt habe. War nicht auch die Qualität der eidgenössischen Gemäldeproduktion gewaltig gestiegen, seit für den Besuch einer Kunsthochschule die Matura als Voraussetzung verlangt wurde, und niemand mehr einfach so ein Bild zusammenpinseln durfte, der nicht den binomischen Lehrsatz beherrschte und die Nebenflüsse des Rheins fehlerfrei aufzählen konnte?
Mit der Abnahme der Prüfung, die allein zur Führung des Titels eines eidgenössisch zertifizierten Schriftstellers (EZS) berechtigte, wurden die kantonalen Erziehungsdirektionen in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Gewerbeaufsichtsämtern beauftragt. Deren gemeinsame Kommission legte in der erstaunlich kurzen Zeit von siebzehn Jahren einen Anforderungskatalog samt Prüfungsordnung vor, die nach Ablauf der Vernehmlassungsfrist und der Behandlung in den kantonalen Parlamenten sechs Jahre später in Kraft trat. Grundsätzlicher Widerstand kam nur aus dem Kanton Wallis, bis man sich dann in einem gut eidgenössischen Kompromiss auf einen Paragraphen einigte, wonach Oskar Freysinger wegen erwiesener Genialität den Titel ehrenhalber erhalten sollte. Den Autoren, die sich schon vor Gültigkeit der Verordnung als Schriftsteller bezeichnet hatten, wurde eine Nachfrist von drei Jahren gewährt, innerhalb derer sie die Prüfung nachholen konnten.
Und alle, alle fielen sie durch.
Peter Bichsel scheiterte an seiner Unfähigkeit, die Hauptstadt des Inselstaates Palau (Melekeok) zu nennen, während Urs Widmer doch tatsächlich nicht in der Lage war, eine Gleichung mit drei Unbekannten zu lösen. (Dass er seine falsche Antwort in Gedichtform abgab, machte die Sache nicht besser.) Milena Moser fiel durch, weil sie auf die Frage nach dem grössten Schweizer Dichter aller Zeiten eine nicht existierende Gottfriedine Keller nannte, und Martin Suter konnte zur Prüfung gar nicht antreten, weil sein Flug aus Guatemala nicht rechtzeitig eintraf.
Alle, alle, alle versagten sie.
So dass seither Oskar Freysinger der einzig wahre Schweizer Schriftsteller ist.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 27. Mai 2012,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats Juni 2012
Musik wird oft nicht schön gefunden, weil sie stets mit Geräusch verbunden.
Wilhelm Busch
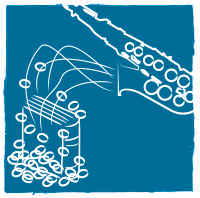
Adolph Sax ist schuld. Hätte er vor hundertsiebzig Jahren nicht die Militärmusik um ein besonders lautstarkes Instrument bereichern wollen und zu diesem Zweck das Saxophon erfunden, würde heute kein Veranstalter auf die Idee kommen, literarische Lesungen durch einen Saxophonisten bereichern zu lassen.
Bereichern? Habe ich eben bereichern geschrieben? Zutröten, wollte ich schreiben. In Stücke blasen, wollte ich schreiben. In Grund und Boden jaulen.
Denn Saxophonisten, vor allem wenn sie als Einzelkämpfer auftreten, sind erbarmungslose Gesellen. Wenn sie einmal losgelegt haben, kennen sie kein Erbarmen. Da können die wehrlosen Zuhörer noch so verzweifelt die weisse Fahne schwenken und um Gnade flehen. Wenn so einer einmal sein Rohrblatt angefeuchtet hat, nützt er es schamlos aus, dass Ohren keine Lider haben. Und es ist ihm völlig egal, dass seine Opfer eigentlich zu einer Lesung gehen wollten.
Pech gehabt. Jetzt ist erst mal der Saxophonist dran. (Oder die Saxophonistin. Ich habe auch schon unter der weiblichen Variante gelitten.)
Der Fairness halber: Es ist nicht immer ein Saxophon, das die Veranstalter aufs Podium schicken. Aber meistens. Ich weiss auch nicht warum. Vielleicht weil Bill Clinton dasselbe Instrument spielt. Aber mit dem hatten ja auch schon andere Leute meines Namens Probleme.
Bevor mir jetzt die Musikliebhaber unter den „Bücher am Sonntag“-Lesern böse Mails schicken: Eigentlich mag ich ja Saxophon-Musik. Cannonball Adderley war neben Coleman Hawkins eines meiner ersten Jazz-Idole. Aber wenn ich eine Lesung habe – danke, nein. Ich mag auch kein Marzipan zum Cervelat vom Grill.
Liebe, hoch verehrte Veranstalter! Eine Lesung ist eine Lesung ist eine Lesung, so wie eine Rose eine Rose eine Rose ist. Kein Podium für musikalische Selbstverwirklichungsakrobaten. Es macht den Abend nicht schöner, runder oder kultureller, wenn da auch noch einer seine teure Selmer aus dem Instrumentenkoffer holt. Mich mit Tönen berieseln lassen kann ich auch in der Warteschlaufe jeder Helpline. Also laden Sie zu meiner nächsten Lesung bitte keinen Saxophonisten ein. Keinen Sologeiger und keinen Triangelspieler. Und – auch wenn ich aus „Melnitz“ lesen sollte – bitte, bitte keine Klezmer-Band.
Als Gegenleistung verpflichte ich mich hoch und heilig, beim nächsten Klavierkonzert keine Kurzgeschichte vorzulesen. Grosses Schriftsteller-Ehrenwort.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 24. Juni 2012,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats August 2012
Dies ist der grösste Fehler bei der Behandlung von Krankheiten, dass es Ärzte für den Körper und Ärzte für die Seele gibt, wo doch beides nicht voneinander getrennt werden kann.
Plato
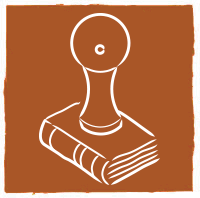
Achtung, Achtung! Dies ist eine Gesundheitswarnung!
Das Bundesamt für die Bekämpfung sprachlicher Epidemien teilt mit:
Leser, die auf Klischees empfindlich reagieren, werden aufgefordert, beim Konsum von Büchern und Zeitschriften in der nächsten Zeit allergrösste Vorsicht walten zu lassen. Besonders sensiblen Personen wird sogar totale Lektüre-Abstinenz empfohlen. In Zweifelsfällen fragen Sie Ihren Buchhändler oder Bibliothekar.
Eine neue Formulierungs-Epidemie breitet sich mit bedrohlicher Geschwindigkeit in den deutschsprachigen Medien aus und droht, auch die Schweiz zu erfassen. Es handelt sich um den sogenannten „Gänsehaut pur“-Virus, dessen Symptome darin bestehen, dass der Befallene alles und jedes, das ihn seelisch bewegt – oder von dem er annimmt, es würde sich gut machen, wenn es ihn seelisch bewegte – als „Gänsehaut pur“ bezeichnet. Auch wenn es sich nur um den Einmarsch von nach Nationalität sortierten Sportlern in ein Stadion handelt. Nach Angaben von Fachleuten soll sich der Infektionsherd in den Reportagekabinen deutscher Sportreporter während der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele befunden haben.
Weitere Ausbrüche der äusserst virulenten GP-Seuche wurden bei der Beschreibung der Begegnung mit einer hübschen jungen Dame, bei der Schilderung einer rasanten Autofahrt und bei der Ankündigung eines neuen Hollywood-Films beobachtet. Die Infektion scheint äusserst ansteckend zu sein und kann sich durch ihre kurze Inkubationszeit sehr schnell verbreiten.
Besonders gefährlich wird sie dadurch, dass die Befallenen keinerlei Beschwerden empfinden, sondern im Gegenteil das Gefühl haben, ungeheuer sprachgewandt, up to date und in zu sein. Manche Opfer der Seuche beschreiben sogar ihren eigenen Zustand bei der Verwendung des Klischees als „Gänsehaut pur“ (sogenannte potenzierte Infektion). Bei diesen Patienten dürfte jede sprachärztliche Hilfe zu spät kommen.
Fachleute befürchten, dass die Seuche aus Fernsehkommentaren und Zeitungsartikeln auch bald zu Buchtiteln und anderen literarischen Formen mutieren könnte und raten zu verstärkter sprachlicher Hygiene.
PS: Trotz ihres Namens ist die „Gänsehaut pur“-Seuche nicht mit der Vogelgrippe verwandt. Man hat noch nie eine Gans „Gänsehaut pur“ sagen hören.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 26. August 2012,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats September 2012
Lesen ist für den Geist, was Freiübungen für den Körper sind.
Joseph Addison
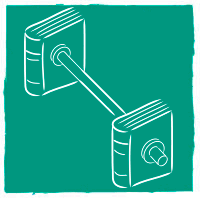
…und zwei und drei und vier und auf und ab und auf und ab, und dann Anlauf und mit Grätsche über die nächste Metapher! Sehr schön! Und jetzt runter und durch das Wortgestrüpp robben! Vorsicht, nicht an den Neologismen hängen bleiben! Schön auf der Satzspur bleiben und nicht schlapp machen, sonst verordne ich euch eine Extrarunde „Finnegans Wake“. Brav, sehr brav.
Und jetzt alle tief durchatmen und zur Erholung in ganz lockerem Joggingtempo durch das Nebensatzlabyrinth. Und Konjunktion und Konjunktion und…
Was ist denn mit Ihnen los, Hugentobler? Was sagen Sie? Über einen Druckfehler gestolpert? Mit solchen Ausreden müssen Sie mir nicht kommen! Sie wissen ja nicht mal, wie man Analphabet buchstabiert! Und legen Sie endlich Ihre nordischen Wanderstöcke weg, wir lesen doch hier nicht Hamsun!
Und jetzt – Achtung, Abschnitt! Nicht darüber stolpern! – wieder Tempo aufnehmen und mit Vollgas durch die nächste Landschaftsbeschreibung! Ja, ich weiss, ich bin ein Sklaventreiber, aber Sie werden mir dankbar dafür sein, glauben Sie mir. Die Stelle, die jetzt kommt, ist so was von langweilig, da sind Sie froh, wenn Sie sich nicht allzu lang damit…
Hugentobler! Sie schummeln ja! Sie haben zwei ganze Zeilen übersprungen! Mindestens zwei Zeilen! Das ist doch hier kein Arztroman, wo es nicht so drauf ankommt! Wir trainieren hier für die Eidgenössische Literatur-Tour! Hier beisst man sich durch! Von der Stirne heiss rinnen muss der Schweiss! Oder wollen Sie den ganzen Verein blamieren?
Was? Zu anstrengend? Dann warten Sie mal ab bis nächste Woche! Da steht Schopenhauer auf dem Trainingsplan. Da werden vielleicht Ihre Synapsen japsen! Auf den Muskelkater in Ihren unterentwickelten Hirnzellen können Sie sich schon mal einstellen.
Also, Hugentobler, noch einmal zurück und diesmal keinen einzigen Buchstaben auslassen. Die andern dürfen am Kapitelende schon mal mit den Dehnungsübungen beginnen.
Und linke Hirnhälfte und rechte Hirnhälfte, und noch mal links und rechts, links und rechts, und jetzt zur Entspannung an gar nichts denken! Aha, das kann er, der Hugentobler, im An-gar-nichts-Denken ist er ein ausgesprochenes Naturtalent.
Also dann, bis zum nächsten Mal, und zwar bitte pünktlich und mit aufgeschlagenen Büchern. Und Sie, Hugentobler, probieren es vielleicht besser mit Makramee!
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 30. September 2012,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats Oktober 2012
Übersetzer sind verwegene Kämpfer, die den Turm von Babel angreifen.
Albert Camus

Als Gott die Menschheit für ihren babylonischen Grössenwahn mit dem Fluch der Vielsprachigkeit belegte, da versuchten die Engel, ihn davon abzubringen. „Bedenke, oh Allgütiger“, sagte Azariel, „dass Mehrsprachigkeit eines Tages dazu führen wird, dass die Leute in den Werbeagenturen ihre eigene Sprache vergessen und Englisch für Deutsch halten.“ Aber er konnte Gott nicht überzeugen, weil Werbeagenturen bekanntlich ein Werk des Teufels sind.
„Berücksichtige, oh Allwissender“, sagte Barachiel, „dass in einer mehrsprachigen Welt die deutschen Gebrauchsanweisungen eines Tages so chinesisch sein werden, dass sie einem spanisch vorkommen.“ Auch davon liess sich Gott nicht erweichen. Wer allmächtig ist, hat kein grosses Interesse an Gebrauchsanweisungen.
Da versuchte es Gabriel, der würdigste der Erzengel, und sprach also: „Bestrafe nicht jene, oh Allerbarmender, die unter der Mehrsprachigkeit unschuldig leiden werden!“
Der liebe Gott wusste in seiner Allwissenheit auch gleich, wen Gabriel damit meinte: Die Übersetzer und Übersetzerinnen von J.K.Rowling. Von ihnen würde man eines Tages verlangen, dass sie das neueste Buch der siebenfachen Potter-Mutter in nur drei Wochen übersetzen sollten. Einundzwanzig Tage lang sollten sie täglich dreiundzwanzig Seiten druckfertiges Manuskript abliefern, und dazu auch noch heilige Schwüre tun, den Inhalt des Buches niemandem zu verraten, schon gar nicht irgendwelchen Journalisten.
„Warum muss es denn so schnell gehen?“, fragte ein kleines Engelchen, dessen Fähigkeit in die Zukunft zu sehen noch nicht sehr weit entwickelt war, und das deshalb nicht wissen konnte, dass das Weihnachtsgeschäft eines Tages wichtiger sein würde als die Qualität einer Übersetzung.
Der liebe Gott, der sich noch gut daran erinnerte, was für ein Stress es gewesen war, die Welt in nur sieben Tagen zu erschaffen, war fast überredet und wollte auf seinen Erlass schon verzichten. Aber weil er auch allgerecht ist, beschloss er J.K.Rowlings erstes Buch für Erwachsene erst mal zu lesen.
Bei der Lektüre von „The Casual Vacancy“ (denn Gott liest natürlich den Originaltext) ist er dann leider eingeschlafen, wie noch viele andere Leser nach ihm. Und so wurde der Befehl zur babylonischen Sprachverwirrung nicht rechtzeitig widerrufen.
Das haben wir jetzt davon.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 28.Oktober 2012,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats November 2012
Es ist schwierig, keine Satire zu schreiben.
Juvenal
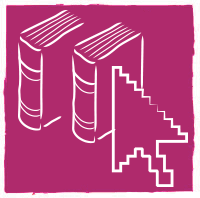
Und dabei hätte es doch einfach ein Buch werden sollen und gar keine Satire. „Klick mich“ heisst das Werk, trägt den werbewirksamen Untertitel „Bekenntnisse einer Internet-Exhibitionistin“ und für sechzehn Euro neunundneunzig kann man es bei Amazon bestellen.
Julia Schramm, die Autorin, ist Mitglied im Bundesvorstand der deutschen Piratenpartei. (Oder müsste das Mitgliedin heissen? Ich bin mit solchen Feinheiten der politischen Korrektheit oft überfordert.) Als führende Piratin vertritt sie selbstverständlich die Forderung aus dem Programm ihrer Partei, „das nichtkommerzielle Kopieren, Zugänglichmachen, Speichern und Nutzen von Werken nicht nur zu legalisieren, sondern explizit zu fördern.“ Das gilt für Filme, für Musik und natürlich auch für Bücher. Auch für solche, die man selber geschrieben hat,
Oops.
Denn damit setzt die Satire ein. Jetzt, wo Julia Schramm gemerkt hatte, wie viel Arbeit so ein Buch macht, und wo sie die Tantiemen schon verplant hatte, jetzt fand sie die Forderung, die sie gerade noch so heftig vertreten hatte, zwar immer noch gut. Nur nicht im eigenen Fall.
Als jemand ihre Bekenntnisse zum kostenlosen Herunterladen ins Netz stellte, liess sie ihren Verlag gegen diese Urheberrechtsverletzung juristisch einschreiten. Auch wer andere Autoren enteignen will, verteidigt den eigenen Geldbeutel mit Zähnen und Klauen.
Die Geschichte erinnert ein bisschen an die – vielleicht apokryphe – Anekdote über A.S.Neill, einen der Begründer der antiautoritären Erziehung. Er habe, so wird gemunkelt, einem Schüler, der mit beschuhten Füssen auf den Tasten seines Pianos herumgetrampelt sei, eine Ohrfeige verpasst. Mit der Begründung: „Natürlich bin ich gegen jede Autorität. Aber das ist mein Klavier.“
Bei A.S.Neill weiss man nicht so genau, ob die Geschichte stimmt. Julia Schramm hingegen war ganz eindeutig der Meinung: „Aber das ist mein Buch!“ Worauf im Netz ein Shitstorm über sie hereinbrach. In der Flut von Verwünschungen, mit denen sie eingedeckt wurde, war „geldgierige Hure“ noch eine der freundlicheren Formulierungen.
Frau Schramm hat ihren Rücktritt aus dem Parteivorstand der Piraten erklärt. Ihre politische Karriere ist vielleicht zu Ende. Aber in die Annalen der ungewollten Satire ist sie ganz bestimmt eingegangen.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 24.November 2012,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«

