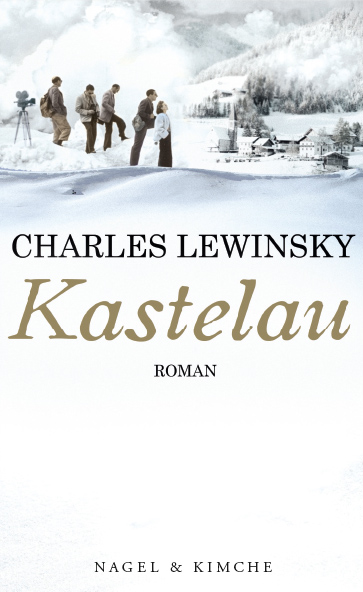
Roman
398 Seiten
2014, Verlag Nagel & Kimche
1944 setzt sich eine Filmequipe der Ufa in die bayerischen Alpen ab, um dort im kleinen Bergdorf Kastelau so zu tun, als ob sie einen Film drehte. Der eigentliche Zweck der Übung ist aber ein ganz anderer: Nicht in Berlin zu sein, wo jeden Tag die Bomben fallen und die russische Armee immer näher kommt. Sie spielen sogar noch Filmdreh, als ihnen schon längst das Filmmaterial ausgegangen ist.
Das kleine Kastelau, vom Schnee eingeschlossen, wird zum Versuchslabor nicht nur für zwischenmenschliche Beziehungen sondern vor allem auch für die hohe Kunst der Heuchelei. Denn je deutlicher sich die deutsche Niederlage abzeichnet, desto mehr verändert sich auch der Film, dessen Herstellung sie vortäuschen. Aus einem Propagandastreifen voller Durchhalteparolen wird allmählich ein Aufruf zum Kampf gegen die Nazis. Denn letzten Endes geht es (fast) allen Beteiligten um etwas viel Wichtigeres als um ihre Überzeugungen. Es geht um ihre Karriere.
Ich erzähle die Geschichte in der Form einer Dokumentation, einer Sammlung von aufgefundenen Briefen, Entwürfen und Protokollen. Wobei alle diese „Dokumente“ frei erfunden sind – sogar die Wikipedia-Artikel.
Übersetzungen:
Russisch
Holländisch
Mathe Hauck war unterwegs zu Franz Reitstaller. Das war der einzige Name, der ihm eingefallen war. Ein zuverlässiger Tonmeister, mit dem er schon einige Male zusammengearbeitet hatte. Zur Wehrmacht eingezogen und auf Grund einer Verwundung wieder entlassen. Was das genau für eine Verwundung war, wusste Hauck nicht, aber Reitstaller, so hieß es, hatte nicht lang im Lazarett gelegen. Falls er arbeitsfähig war, wenn auch eingeschränkt, war das vielleicht die Lösung. Man konnte vieles einsparen und improvisieren, aber ganz ohne Ton ging es nicht. Und es musste einfach gehen. Seit Mathe Hauck von der Möglichkeit gehört hatte, seine Arbeit weit weg von Sirenen und Bomben zu tun, konnte er an nichts anderes mehr denken.
Reitstaller war nicht ausgebombt. Eine ganze Häuserzeile ohne jede Beschädigung. Nummer 16. Nummer 14. Nummer 12. Ein Mann an zwei Krücken balancierte die drei Stufen von der Haustür herunter. Zum Glück war es nicht der Tonmeister. Ein Mann um die dreißig, unterschenkelamputiert. Seltsam, dachte Hauck, wie wir alle neue Fähigkeiten entwickeln. Erkennen die Art einer Verwundung auf den ersten Blick. Allein daran, wie jemand seine Krücken benutzt.
Auf jedem Treppenabsatz stand der vorschriftsmäßige Eimer mit Sand zum Löschen von Stabbrandbomben. „Und mit einem Eimer Sand rettet er das Vaterland.“
Aus Reitstallers Wohnung schepperte Marschmusik, so laut, dass Hauck nicht hören konnte, ob die Klingel funktionierte. Er drückte nochmal auf den Knopf, klopfte auch an – keine Reaktion. Unterdessen lief schon das nächste Musikstück, wieder so ein Jubelmarsch mit wirbelnden Trommeln und schmetternden Trompeten. Im Rundfunk wurde immer noch pausenlos gesiegt.
Er stand unschlüssig da, als eine verhärmte junge Frau die Tür der Nachbarswohnung öffnete. Vielleicht gehörte sie zu dem Kriegsbeschädigten, den er vor dem Haus gesehen hatte. „Gehen Sie nur hinein“, schrie sie. In normaler Lautstärke hätte man sie über dem Lärm der Musik nicht gehört. „Er lässt die Tür jetzt immer offen.“
Die Musik kam aus dem Wohnzimmer. Ein Volksempfänger, auf maximale Lautstärke gedreht, so wie man es bei Führerreden machte. Reitstaller saß in einem Sessel am Fenster und schaute auf die Straße hinaus. Er zeigte keine Reaktion, als Hauck hereinkam. Auch als der das Radio ausschaltete, die plötzliche Stille wie ein Schlag, drehte er erst nach ein paar Sekunden den Kopf.
„Kennst du mich noch?“, fragte Hauck.
„Ja“, sagte Reitstaller. Auch seine Stimme überlaut, an die Musik angepasst. „Ja, ja.“
„Mathe Hauck von der Bavaria. Vierundzwanzig Stunden. Du erinnerst dich bestimmt an den Film. Da hatten wir zum ersten Mal miteinander zu tun.“
„Ja, ja“, sagte Reitstaller.
„Und jetzt würde sich die Gelegenheit ergeben… Bist du eigentlich wieder arbeitsfähig?“
„Ja“, sagte Reitstaller. Und dann, immer noch mit dieser zu hoch aufgedrehten Stimme: „Wer sind Sie?“
„Hauck. Mathe Hauck. Von der Bavaria. Wir haben ein paar Mal…“
Reitstaller schüttelte den Kopf und hielt eine Hand in die Höhe, ein Schupo, der den Verkehr zum Stehen bringt. Er nahm ein Schulheft vom Fensterbrett, schlug es auf und hielt es Hauck hin. Karierte Seiten mit Einträgen in verschiedenen Schriften. „Heute kein Brot“ und „Scheuerpulver ist alle“. Reitstaller hielt ihm einen Bleistift hin. „Ich höre ein bisschen schlecht“, sagte er. Brüllte er.
Direkt unter „Fliegeralarm“ schrieb Hauck seinen Namen hin.
„Natürlich“, sagte Reitstaller. „Du bist doch der mit dem kaputten Knie. Glückspilz. Mich haben sie an die Front geschickt.“
„Was fehlt dir genau?“, schrieb Hauck in das Heft.
„Nichts Besonderes. Volltreffer in ein Munitionslager. Mir ist nichts passiert. Nur mein Trommelfell…“ Reitstaller riss eine Seite aus dem Schulheft, zerfetzte sie in kleine Schnipsel und ließ sie zu Boden rieseln. „Sie können mich nicht mehr brauchen, weil ich ja keine Befehle mehr höre. Ich drehe nur noch Stummfilme.“
“Wird das wieder besser?“, schrieb Hauck.
„Klar“, schrie ihm Reitstaller ins Gesicht. „Wenn ich tot bin.“ Hauck musste zusammengezuckt sein, denn der Tonmeister entschuldigte sich. „Tut mir leid. Ich kann den Pegel nicht mehr regulieren.“
„Und arbeiten?“, schrieb Hauck.
Reitstaller lachte, bis ihm der Atem ausging. „Du hast Humor, Volksgenosse“, japste er schließlich. „Du hast wirklich Humor.“
NZZ AM SONNTAG, 17.8.2014
Lügengespinst
Charles Lewinsky erzählt in seinem vielstimmigen neuen Roman «Kastelau» von einem Filmteam der Ufa, das Ende 1944 vorgibt, einen Propagandafilm zu drehen. Das Buch ist ein Meisterstück der Camouflage. Von Manfred Papst
Im Deutschland Hitlers hiess er Walter Arnold und spielte in Ufa-Filmen wie «Fahrt ins Glück», «Gefreiter Gebhardt» und «Die eiserne Faust» mit; nach Kriegsende machte er als Arnie Walton in Hollywood Karriere. Unvergessen ist er als Charakterdarsteller etwa in «The Prize of Freedom», «Don’t Ask!» und «Sing While You Can». Dass der wandlungsfähige Mime, der von 1914 bis 1991 lebte, in 13 deutschen sowie 19 amerikanischen Filmen tragende Rollen spielte und für sein Lebenswerk mit einem Stern auf dem «Walk of Fame» ausgezeichnet wurde, heute so gut wie vergessen ist, muss erstaunen. Selbst Cineasten ist er kaum noch ein Begriff.
Das dürfte sich mit dem neuen Buch von Charles Lewinsky ändern. Denn der weltläufige Schweizer Autor ist bei seinen Recherchen auf den Nachlass eines gewissen Samuel Anthony Saunders gestossen, ehedem Besitzer einer Videothek in Santa Monica und Hobby-Filmhistoriker. Dieser Saunders hatte viele Jahre lang Material für ein Buch über Arnie Walton gesammelt, aber weder ein Ende noch einen Verleger gefunden. Der Bestand, der im Film- und Fernseharchiv der University of California in Los Angeles einzusehen ist, umfasst Briefe, Tagebücher, Tonaufzeichnungen von Interviews mit Zeitzeugen, Zeitungsausschnitte, Auszüge aus Drehbüchern, Ausdrucke von Wikipedia-Einträgen und vieles mehr.
Lewinsky hat sein Bestes getan, um aus dem ungeordneten Material so etwas wie eine schlüssige Dokumentation zusammenzustellen. Ob seine Collage wissenschaftlichen Ansprüchen genügen kann, muss uns hier nicht beschäftigen. Spannend und welthaltig, skurril und farbig ist das, was er mitzuteilen hat, allemal.
Saunders› Recherchen zeigen nämlich, dass Arnie Walton keineswegs der Widerstandskämpfer gewesen war, als den er sich in seiner 1984 erschienenen Autobiografie «From Berlin to Hollywood: An Actor’s Journey» darstellte. Vielmehr belegen die Dokumente mit erdrückender Beweislast, dass er ein Mitläufer, Wendehals und skrupelloser Karrierist war, der nicht einmal vor einem hinterhältigen Verbrechen zurückschreckte, um im April 1945 seine Haut zu retten.
Die von Lewinsky vorgelegte Quellensammlung konzentriert sich auf die letzten Monate des Zweiten Weltkriegs. Täglich fliegen die Alliierten Bombenangriffe auf die deutsche Hauptstadt. Wer fliehen kann, der tut es. Auch ein Filmteam der Ufa setzt sich ab. Es verschafft sich mit einer List den Auftrag für ein angeblich kriegswichtiges Projekt namens «Lied der Freiheit», einen Propagandafilm, der die Deutschen zum Durchhalten animieren soll. Gedreht wird in Kastelau, einem kleinen Wintersportort bei Berchtesgaden in Oberbayern. Doch nur ein kleiner Teil der Crew und der Gerätschaften kommt dort überhaupt an. Man bezieht Quartier in einem Gasthof, der eigentlich geschlossen hat. Bald ist man eingeschneit. An ernsthaftes Arbeiten ist unter diesen Umständen kaum zu denken. Dennoch muss der Schein aufrechterhalten werden, damit man in der von einem strammen Nazi regierten Gemeinde wohlgelitten bleibt.
Das Filmteam steht vor einer schier unlösbaren Aufgabe: Es muss emsige Arbeit vortäuschen und gleichzeitig darauf achten, dass diese sich so lange wie möglich hinzieht. Mit dem knappen Filmmaterial muss man sparsam umgehen. Und natürlich kommt es in der «Huis Clos»-Situation des Gasthofs zu Eifersüchteleien, Intrigen, Machtkämpfen und Heimlichkeiten, die das Zusammenleben auf engem Raum nicht gerade einfacher machen. Das multiple Versteckspiel führt zu immer neuen Ausflüchten; am Ende ist das Lügengespinst kaum mehr zu entwirren.
Zudem wird im Lauf dieser Winterwochen immer deutlicher, dass der Krieg verloren ist, dass die Amerikaner näher rücken und dass es wohl opportun ist, aus dem Nazifilm «Lied der Freiheit» ein Werk des Widerstands zu machen. Dazu werden die bereits gedrehten Szenen mit List und Tücke umgeschnitten und notdürftig mit nachgedrehten Sequenzen ergänzt. Das Drehbuch und sein Autor haben in dieser Phase viel zu leiden. Am Ende kommt es im Team zu einem Showdown mit tödlichem Ausgang.
Für Saunders wie für Lewinsky war es ein Glücksfall, dass zwei Leute, die damals dabei waren, ausführliche Berichte hinterlassen haben. Es handelt sich dabei um den Schriftsteller Werner Wagenknecht und um die Schauspielerin Tiziana Adam. Beide waren merkwürdige, schillernde Persönlichkeiten. Wagenknecht, der 1898 in Fürstenwalde geboren wurde und 1945 in Kastelau starb, begann mit expressionistischer Lyrik in der Nachfolge Trakls. Erfolgreich war er mit zwei Romanen: dem Antikriegsbuch «Kommando Null» (1925) sowie mit «Stahlseele» (1930), einem sozialkritischen Werk über das Leben einer Berliner Arbeiterfamilie im Sturm von Weltwirtschaftskrise und Inflation. Mit diesen Werken wurde Wagenknecht nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten natürlich zur Unperson. Seine Bücher wurden verbrannt, er wurde mit einem totalen Publikationsverbot belegt. Um sich gleichwohl über Wasser zu halten, schrieb er unter verschiedenen Pseudonymen Drehbücher für die Ufa. Für die Recherche über Arnie Walton ist er deshalb besonders wichtig, weil er zeit seines Lebens und also auch während der Wochen in Kastelau akribisch Tagebuch führte und darüber hinaus einige Schlüsselepisoden zu Erzählungen ausbaute.
Kratzbürstige alte Dame
Zu Wagenknechts Aufzeichnungen kommen die Interviews, die Saunders zwischen Anfang August und Ende Oktober 1986 mit der ehemaligen Schauspielerin Tiziana Adam führen konnte. Sie war damals eine Dame von 72 Jahren und so kratzbürstig wie witzig. Es muss Charles Lewinsky Vergnügen bereitet haben, die mit einem alten Uher-Gerät aufgezeichneten Gespräche zu transkribieren, auch wenn die Arbeit sich aufgrund der schlechten Tonqualität mühsam gestaltete. Tiziana Adam führte damals eine eher schäbige Kneipe namens «Bei Titi» in Wiesbaden, die für Filmfreaks wegen der vielen historischen Fotos von Kinostars und der Musikbox mit alten Schlagern aber ein beliebter Treffpunkt war. Saunders ist es offenbar gelungen, die Sympathie der kettenrauchenden Dame mit der herrlich frechen Schnauze zu gewinnen, denn nachdem sie ihn anfänglich tüchtig hat zappeln lassen, erzählt sie ihm höchst freimütig aus ihrem Leben. Ihre Erinnerungen und Reflexionen mögen bisweilen lückenhaft sein, doch sie tragen durch ihre Farbigkeit und Ungeschminktheit wesentlich dazu bei, Licht in die dramatische Entstehungsgeschichte des Filmprojekts «Lied der Freiheit» zu bringen.
Mit den Mitteln des Films
Bleibt die Frage, warum Charles Lewinsky seine Dokumentation dieses Falls als Roman bezeichnet. Die Antwort ist schlicht: weil alles in ihr erfunden ist. Kastelau gibt es nicht. Weder Arnie Walton noch Werner Wagenknecht noch Tiziana Adam haben je gelebt. Die Wikipedia-Einträge, die Filmografien im Anhang, die Auszüge aus Wochenschauen, die Drehbücher: alles gefälscht.
Das ist zunächst einmal ein grandioser literarischer Spass. Er erlaubt es Lewinsky, zu zeigen, was für ein virtuoser Schriftsteller er ist. Ein grandioser Stimmenimitator und gewiefter Dramaturg, der seine verschiedenen Textsorten so zu collagieren versteht, dass sie sich tatsächlich zu einem spannenden Roman formen.
«Kastelau» ist aber weit mehr als ein raffinierter Scherz. Wie Wolfgang Hildesheimers fiktive Biografie «Marbot» (1981) hat es einen sehr ernsten Untergrund. Es erzählt eine tragikomische Geschichte um Liebe und Verrat, um Ehrgeiz und Feigheit. Es wartet mit einem Ensemble von vielschichtigen und überzeugenden Figuren auf und stellt sie in ein stimmiges Zeitkolorit. Sowohl die Dorfbewohner als auch die Filmcrew wirken in ihrer differenzierten Zeichnung glaubhaft.
In Charles Lewinskys neuem Buch spiegeln sich zudem Inhalt und Methode. Es erzählt uns in vermeintlich nüchterner Art die Geschichte einer Täuschung und täuscht uns dabei selber ein ums andere Mal. Damit erinnert es an einen Zauberer, der vorgibt, einen Trick zu erklären, und uns dabei erneut hinters Licht führt. Insofern ist «Kastelau» auch ein philosophisches Buch über die Möglichkeiten der Phantasie und des doppelten Spiels. Es erinnert immer wieder an Ernst Lubitschs 1942 in den USA gedrehtes Meisterwerk «To Be or Not to Be», das im Warschau von 1939 spielt.
Aufmerksame Leser stossen übrigens ganz zu Beginn des Buchs auf eine Fussnote, die sie vielleicht als Insider-Witz verstehen: Die Adresse des Film & Television Archive der UCLA wird mit «302 East Melnitz» angegeben. Wer dächte da nicht an Lewinskys 2006 erschienenen Erfolgsroman «Melnitz»! Aber die Adresse stimmt. Manchmal treibt eben auch die Wirklichkeit ihre Scherze.
Mehr zum Buch in diesem Interview des Bayerischen Rundfunks
Wenn Sie sich lieber ein Kapitel von mir vorlesen lassen wollen, dann geht das hier.
Zurück zur Übersicht
