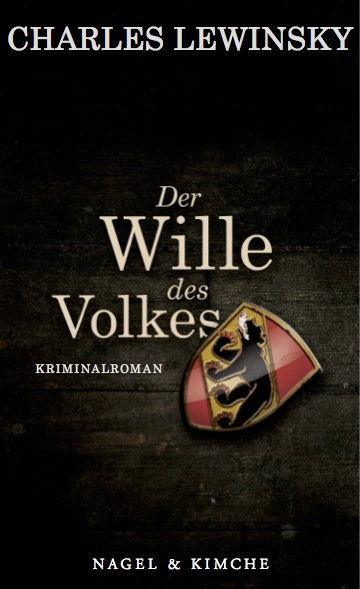
Roman
384 Seiten
Verlag Nagel & Kimche, 2017
Mein erster Kriminalroman. Obwohl es eigentlich gar kein Kriminalroman ist, sondern eine Politsatire. Oder eine dystopische Beschreibung der Schweiz. Oder ein bisschen von allem.
Der „Wille“ aus dem Titel ist der schon längst schwerkranke, aber immer noch allgemein verehrte Vorsitzende einer Partei die – um es vorsichtig auszudrücken – am rechten Flügel des Politspektrums angesiedelt ist. Am sehr rechten Flügel. Die „Eidgenössischen Demokraten“ haben es sowohl in den Kantonen wie im Bund geschafft, bei den Wahlen absolute Mehrheiten zu gewinnen, und sie tun alles, um das Land nach ihren Vorstellungen umzuformen: ordentlich, konservativ und mit einer grossen Menge gegenseitiger Kontrolle. Ihr Ziel ist eine rundum saubere Schweiz – und um das zu erreichen, dürfen die Mittel schon einmal ein bisschen schmutzig sein.
Die Hauptfigur des Romans ist der längst schon abgehalfterte Journalist Kurt Weilemann, der – obwohl eigentlich schon längst in schlecht finanzierter Rente – versucht, die Umstände eines Unfalls aufzuklären, von dem er nicht glaubt, dass es ein Unfall war. Bei seinen Nachforschungen gerät er auf die Spur eines politischen Komplotts. Aber in einem gut organisierten Staat, setzt sich die Wahrheit nicht automatisch durch. Nicht wenn sie der regierenden Partei nicht in den Kram passt.
Die Auflösung des Kriminalfalls will ich hier natürlich nicht verraten. Nur so viel: Der Mörder ist definitiv nicht der Gärtner.
Übersetzungen:
Russisch
Manchmal nahm Weilemann den Hörer ab, obwohl es gar nicht geklingelt hatte, nur um zu überprüfen, ob da überhaupt noch ein Summton war. Es ging immer mal wieder das Gerücht, die Festanschlüsse sollten ganz abgeschafft werden, weil sie nicht mehr wirklich gebraucht wurden, wo doch jeder sein Handy hatte oder etwas noch Moderneres, er selber auch, es ging nicht ohne. Als damals die letzte Telefonzelle außer Betrieb genommen worden war, da hatte er noch einen Artikel darüber geschrieben, nichts Besonderes, „Ende einer Ära“ und so, und der war dann nicht einmal erschienen, weil kurz vor Redaktionsschluss die Nachricht hereingekommen war, ein Fernsehmoderator, so ein Drei-Tage-Star mit Drei-Tage-Bart, sei gar nicht wegen einer Blinddarmentzündung in der Klinik gewesen, sondern habe sich heimlich Fett absaugen lassen; da war der Platz für sein Artikelchen natürlich weg gewesen. „kw“ hatte sein Kürzel geheißen, für Kurt Weilemann, und alle, die ihn kannten, hatten ihn Kilowatt genannt. Damals, als es noch Leute gab, die ihn kannten.
Das war jetzt auch schon wieder lang her. Ein alter Sack war er geworden, ein altmodischer alter Sack, er sagte das von sich selber und zwar mit einem gewissen Stolz, er war retro, so wie das Wort „retro“ auch schon selber retro geworden war, in einem Text hätten sie es ihm rausgestrichen, weil es niemand mehr verstand. Oder es wäre drin geblieben, weil sich ja heutzutage keiner mehr die Mühe machte, einen Artikel gegenzulesen, kaum in die Tastatur gehackt und schon im Internet. E-Paper – wenn er das Wort nur hörte, kam ihm die Galle hoch.
Dabei war es nicht so, dass ihn all die neuen Erfindungen überfordert hätten, überhaupt nicht, er war ja nicht verkalkt, er sah nur nicht ein, warum man sich ständig umstellen sollte, wenn die Dinge doch gut funktionierten, so wie sie waren. Da gab es diesen neuen Commis zum Beispiel, dieses supermoderne Gerät, das jetzt jeder haben musste, nur er hatte sich dieses Spielzeug noch nicht einmal angesehen. Solang man selber denken konnte, das war sein Standpunkt, brauchte man kein solches Hilfsgehirn, aber die Werbung redete den Leuten halt ein, man sei kein vollwertiger Mensch, wenn man keines habe. Immerhin: den Begriff „Communicator“ hatten sie mit all ihren Werbespots nicht durchdrücken können, da war das Schweizerdeutsche stärker gewesen, man sagte „Commis“, das alte Wort für einen Büroangestellten, und das war auch passend, so ein Bürogummi hatte ja auch all die tausend Dinge erledigen müssen, für die sein Chef keine Zeit hatte. Seinen Coiffeur, der ihm mit der Aufzählung all der tollen neuen Apps auf die Nerven gegangen war, hatte er mal gefragt: „Kann man sich mit dem Ding auch rasieren?“, aber der Spruch war nicht angekommen, einerseits weil niemand mehr Ironie verstand, und andererseits weil sich ohnehin kaum mehr jemand rasierte. Man machte das jetzt mit einer Creme, die musste man nur einreiben, und eine Minute später konnte man sich die Stoppeln aus dem Gesicht waschen und hatte eine Woche Ruhe. Er selber benutzte immer noch seinen elektrischen Rasierapparat, und sein Telefon zuhause hatte ein richtiges Telefon zu sein, nicht so ein Spielzeug, das man immer erst suchen musste, wenn es läutete, weil es ohne Kabel ja keinen festen Platz mehr hatte. Sein altes Swisscom-Gerät funktionierte noch tipptopp, und selbst dieses Museumsstück konnte mehr, als er brauchte, zehn Tasten zum Einprogrammieren von Telefonnummern, wo doch Weilemann auch mit viel Nachdenken keine zehn Leute zusammengebracht hätte, die er hätte anrufen wollen, genauso, wie es keine zehn Leute mehr gab, die bei ihm angerufen hätten. Markus meldete sich seit dem letzten großen Krach überhaupt nicht mehr, es war definitiv ein Fehler gewesen, sich mit seinem Sohn auf politische Debatten einzulassen, Freunde hatte er nie viele gehabt, und die Kollegen waren einer nach dem andern auf den Friedhof umgezogen. Und dass jemand Arbeit für ihn hatte, kam auch nur alle Jubeljahre vor.
Er war in dem Alter, wo die Redaktionen nur noch anriefen, wenn wieder einer gestorben war, und sie einen Nachruf brauchten. „Sie haben ihn doch noch gekannt“, sagten die jungen Schnösel dann am Telefon und hatten so wenig Sprachgefühl, dass sie nicht merkten, wie verletzend dieses „noch“ klang. „Die andern aus deiner Generation“, hieß das, „sind schon lang durch den Rost, nur dich hat man vergessen abzuholen.“ Manchmal riefen sie nicht einmal an, sondern schickten bloß eine E-Mail, meistens ohne Anrede, hielten Höflichkeit wohl für eine ausgestorbene Tierart, machten sich nicht einmal die Mühe, ganze Sätze zu schreiben, oder hatten das verlernt, rotzten nur ein paar Stichworte in die Tastatur, den Namen des Toten und die Anzahl der Zeichen, die sie haben wollten, zwölfhundert für eine gewöhnliche Leiche, inklusive Leerzeichen, und manchmal noch weniger. Da hatte einer ein Leben gelebt, hatte sich abgerackert und etwas geschafft, und dann gönnten sie ihm noch nicht einmal eine ganze Spalte.
Zu seiner Zeit …
Weilemann ärgerte sich immer, wenn er „zu meiner Zeit“ dachte, das war ein Zeichen von Vergreisung, und so weit war er noch lang nicht, auch wenn er sich, um seinen Fahrausweis zu behalten, schon zweimal einem Checkup hatte stellen müssen, eine völlig überflüssige Prozedur, einen Wagen konnte er sich schon lang nicht mehr leisten, und warum man für die die modernen Autos einen Ausweis haben musste, hatte er sowieso nie verstanden, eigentlich brauchten die überhaupt keinen Fahrer mehr, zumindest nicht in der Stadt. „Verkehrsmedizinische Kontrolluntersuchung“, auch so eine scheußliche Bürokratenformulierung, aber wenn einer anständiges Deutsch schreiben konnte, sortierten sie ihn wahrscheinlich schon bei der Bewerbung aus, diese beamteten Analphabeten. Er war nur aus Prinzip hingegangen, um sich selber zu beweisen, dass er noch voll im Schuss war, hatte sich vorher die Liste mit den Mindestanforderungen aus dem Internet gefischt, und es war eine Frechheit gewesen, was da alles bestätigt werden sollte, eine ausgesprochene Frechheit. „Keine Geisteskrankheiten. Keine Nervenkrankheiten mit dauernder Behinderung. Kein Schwachsinn.“ Als ob man mit dem siebzigsten Geburtstag automatisch senil würde. Er hatte die Kontrolle beide Male mit fliegenden Fahnen bestanden, nein, nicht „mit fliegenden Fahnen“, korrigierte er die Gedankenformulierung, das war ein dummes Militaristenklischee, mit Leichtigkeit hatte er sie bestanden. Bei ihm war ja auch alles in Ordnung. Das Hüftgelenk konnte man sich, wenn es schlimmer werden sollte, irgendwann ersetzen lassen.
Er war noch voll da, total arbeitsfähig, aber eben, wenn sie überhaupt einmal an ihn dachten, dann war bestimmt jemand gestorben. Und wahrscheinlich hatte der Volontär, der dann gnädig bei ihm anrief – sie beschäftigten nur noch Volontäre, schien ihm, die gestandenen Journalisten mussten froh sein, wenn sie für die Apothekerzeitung die Vorteile gesunder Ernährung bejubeln durften –, wahrscheinlich hatte der minderjährige Agenturmeldungsabschreiber, bevor er das Telefon in die Hand nahm, noch einen Kollegen gefragt: „Lebt der überhaupt noch, dieser Weilemann?“
Ja, er lebte noch, auch wenn man manchmal das Gefühl haben konnte, man müsse sich dafür entschuldigen, dass man noch nicht bei Exit angerufen und sich hatte entsorgen lassen. Man war kein nützliches Mitglied der Gesellschaft mehr, nur noch eine Belastung für die AHV.
Manchmal, wenn er schlechte Laune hatte, nicht die alltägliche dunkelgraue, sondern die rabenschwarze, überlegte er sich, wen sie wohl anfragen würden, wenn sein eigener Nachruf fällig würde. Falls sie den Platz nicht für etwas Wichtigeres brauchten, die Verlobung einer Schlagersängerin oder den Seitensprung eines Fußballspielers. Ihm fiel dann immer nur Derendinger ein, der war noch der letzte von der alten Garde, Derendinger, mit dem er sich immer nur gefetzt hatte, am Anfang wegen ihrer politischen Meinungsverschiedenheiten und dann später aus Gewohnheit. Derendinger würde sich ein paar freundliche Floskeln aus den Fingern saugen, so wie er es auch selber für Derendinger machen würde, „ein Journalist der alten Schule“ und so, zwölfhundert Zeichen und Deckel drauf. De mortuis nil nisi bonum. „Bonum“ und nicht „bene“. Aber Latein konnte auch keiner mehr.
Man sollte sich seinen Nachruf selber schreiben dürfen, dachte Weilemann, und hatte es auch schon versucht, nur aus Jux, man wollte ja nicht aus der Übung kommen, aber zwölfhundert Zeichen waren immer zu wenig gewesen; man hatte doch eine Menge gemacht im Lauf der Jahre. Nur schon der Fall Handschin damals, als er besser recherchiert hatte als die Polizei, die richtige Spur verfolgt und einen Unschuldigen aus dem Gefängnis geholt, dafür hätte man allein schon tausend Zeichen gebraucht, mindestens. Er hatte immer ein Buch über den Fall schreiben wollen, hatte sogar die Anfrage von einem Verlag gehabt, aber damals war er zu beschäftigt gewesen, und heute, wo er Zeit zum Versauen hatte, interessierte sich niemand mehr dafür.
Bücher wurden ja auch gar nicht mehr gelesen, nicht auf Papier auf jeden Fall, genau so wenig wie die Leute noch Zeitungen lasen, richtige Zeitungen, die am Morgen im Milchkasten lagen, und die man dann beim ersten Espresso des Tages in aller Ruhe studierte, zuerst Politik und Wirtschaft, dann das Lokale und ganz am Schluss, als Nachtisch, auch noch den Sport. Es gab die gedruckten Zeitungen noch, so viel Traditionsbewusstsein hatten sie, aber es legte sie niemand mehr in den Milchkasten. Zeitungsausträger waren ausgestorben, so wie Minnesänger ausgestorben waren oder Lampenputzer, dabei wären seit dem Krach mit Europa weiß Gott genügend Leute dagewesen, die keine Arbeit mehr fanden, weil sie eben nur Leute waren und keine Fachleute. Es rechnete sich nicht mehr, ein paar Abonnenten die Zeitungen ins Haus zu bringen. Wer immer noch darauf bestand, sie auf althergebrachte Weise zu lesen, musste mühselig zum Kiosk latschen, und wenn man einmal verschlafen hatte, waren sie oft schon ausverkauft. Dann musste man seine Zeitung am Bildschirm lesen, und das war ja nun wirklich, als ob man eine Frau durch so einen hygienischen Mundschutz hindurch küssen würde.
Papier, die beste Erfindung der Menschheit, verschwand immer mehr aus der Welt. Bei der ZB hatten sie doch tatsächlich ernsthaft darüber nachgedacht, neunzig Prozent ihres Bestandes einzustampfen, weil die Bücher ja alle digitalisiert zugänglich seien; der Vorschlag war zwar abgeschmettert worden, aber es würde noch so weit kommen, davon war Weilemann überzeugt, irgendwann würde es noch so weit kommen. Ganz gut, dass man nicht mehr der Jüngste war, wenigstens das würde man nicht mehr erleben müssen.
Er selber liebte den Geruch von altem Papier, schnitt immer noch Zeitungsartikel aus und bewahrte sie auf, obwohl es das alles auch im Internet gab. Für die Stapel auf seinem Schreibtisch brauchte er keine elektronische Suchfunktion, hätte auch gar keine haben wollen, damit fand man immer nur, was man gesucht hatte, den immer gleichen Googlehopf, und machte keine dieser zufälligen Entdeckungen, die doch das Interessanteste waren. Und wenn es ein bisschen länger dauerte – à la bonheur, Zeit hatte er, viel zu viel Zeit. Die Leute sagten zwar, die Tage gingen mit jedem Lebensjahr schneller vorbei, aber ihm kam es genau umgekehrt vor; jeden Morgen versuchte er, noch ein bisschen länger liegen zu bleiben, um schon mal ein bisschen von der Langeweile einzusparen, die ihn erwartete, aber das funktionierte nicht, immer schlechter funktionierte es, in seinem Alter hätte man mehr Schlaf gebraucht und bekam immer weniger davon; es war schon etwas dran an dem Gerede von der präsenilen Bettflucht.
Da müsste man mal etwas drüber schreiben, dachte er automatisch und ärgerte sich genauso automatisch darüber, dass dieser Reflex in seinem Kopf immer noch lebendig war. Er musste sich endlich daran gewöhnen, dass niemand mehr einen Text von ihm haben wollte, höchstens noch einen Nachruf, und auch den nur, wenn der Verstorbene zur Cervelat-Prominenz von vorgestern gehört hatte, ach was, nicht einmal Cervelat, Cippolata bestenfalls, lauter ganz kleine Würstchen. Bei den interessanten Toten kam er nicht in die Kränze, die waren für die Chefs reserviert, die sich für Edelfedern hielten, bloß weil sie die teureren Schreibtischsessel hatten. Er war sich ganz sicher, dass sie schon alle heimlich an einem Nachruf auf Stefan Wille herumbastelten, bei dem es ja, nach allem, was man aus den Bulletins der Krankenhausärzte herauslesen konnte, nicht mehr lang dauern würde. Ein Nachruf auf Wille, das wäre eine interessante Aufgabe, den würde man nicht in zwölfhundert Zeichen abfertigen müssen, und er, Weilemann, würde es auch ganz anders machen, nicht so, wie sie wohl alle schon pfannenfertig in ihren Computern hatten, er würde auch Kritisches schreiben und nicht versuchen, wie es mit Sicherheit zu erwarten stand, dem Herrn Parteipräsidenten auch noch posthum in den Arsch zu kriechen. Aber es würde niemand einen Wille-Nachruf bei ihm bestellen, und wenn sie ihn bestellten, würden sie ihn nicht abdrucken.
„‚Abdrucken‘ ist ein altmodisches Wort. Bald drucken sie überhaupt nicht mehr.“ Er merkte, dass er das laut ins leere Zimmer hinein gesagt hatte, und ärgerte sich über sich selber. Wenn einer anfing, Selbstgespräche zu führen, das war immer seine Überzeugung gewesen, dann war er reif fürs Altersheim.
Das Telefon läutete dann natürlich, als er auf dem WC saß. Typisch. Aber ein Auftrag war ein Auftrag, und seit die AHV-Ansätze zum zweiten Mal gekürzt worden waren, konnte man sich nicht leisten, einen zu verpassen. Weilemann humpelte also mit heruntergelassener Hose ins Wohnzimmer zurück. Allein zu leben hatte auch seine Vorteile.
LUZIA STETTLER
Schweizer Krimi Düster und komisch: Lewinskys Politsatire über die Schweiz
Charles Lewinsky legt seinen ersten Krimi vor: «Der Wille des Volkes». Darin zeigt er uns eine Schweiz in naher Zukunft, die völlig nach rechts gerutscht ist. Parteifunktionäre gehen über Leichen, um ihre Macht zu sichern. Eine witzige Politsatire, bei der sich reale Vergleiche aufdrängen.
Felix Derendinger, pensionierter Journalist, stöbert in einem alten Kriminalfall und macht eine brisante Entdeckung, die das Land erschüttern würde. Nur kommt er nicht mehr rechtzeitig dazu, die Bombe platzen zu lassen: Er stirbt überraschend. Offiziell an den Folgen eines Unfalls. Aber für seinen einstigen Berufskollegen Kurt Weilemann ist klar: Derendinger wurde umgebracht.
Nun ist es an Weilemann, die Recherchen fortzusetzen. Der Schlüssel liegt beim ehemaligen Parteipräsidenten der «Eidgenössischen Demokraten», Werner Morosani, der vor mehr als 30 Jahren auf dem Heimweg ermordet worden war.
Man schob die Schuld einem schwarzen Asylbewerber in die Schuhe und schloss die Akte. Der tragische Todesfall brachte den «Eidgenössischen Demokraten» viele Sympathiestimmen. Die Partei legte kräftig zu bei darauffolgenden Wahlen. Für den politischen Ziehsohn von Morosani, Stefan Wille, wurde die Bahn frei für eine beispiellose Politkarriere. Noch heute ist Stefan Wille der wichtigste Mann bei den «Eidgenössischen Demokraten». Mittlerweile alt, krank und gebrechlich, zieht er immer noch die Fäden im Hintergrund und wird von seinen Parteigenossen verehrt wie ein Gott. Denn er ist «der Wille des Volkes».
Kein Wunder muss um jeden Preis verhindert werden, dass dieses Heiligenbild durch alte Geschichten beschmutzt wird. Also werden alle Register gezogen, um Weilemann das Handwerk zu legen.
Mit viel Witz und Humor treibt Charles Lewinsky seinen Plot vorwärts, verzichtet auf billige Pointen und schafft es, seinen Spass am Stoff auch auf die Leserinnen und Leser zu übertragen. Geschickt jongliert er mit verschiedenen Motiven, baut überraschende Indizien ein und lässt seinen Ermittler Weilemann die ungewöhnlichsten Fährten aufnehmen. Die Spuren führen tief in den Schweizer Politsumpf am rechten Flügel.
Auf die Frage, ob er absichtlich provoziere, um das Buch ins Gespräch zu bringen, winkt Charles ab. Nein, die Geschichte habe diese Zuspitzung gebraucht. Wer sich darin gespiegelt sehe, sei selber schuld. Trotzdem: Die Vergleiche mit der realen Schweizer Politlandschaft drängen sich auf. Unschwer glaubt man die SVP wieder zu erkennen mit ihrem Übervater Christoph Blocher.
Natürlich verneint Charles Lewinsky, er habe sich von diesen Vorbildern inspirieren lassen. Er verhehlt aber nicht, dass er alles andere als ein rechtskonservativer Wähler sei. Politik hält er für «ein schmutziges Geschäft», bei dem schon mancher den redlichen Weg verlassen musste, um an die Macht zu kommen. Da sei die Schweiz nicht besser als «irgendeine Bananenrepublik».
Mit «Der Wille des Volkes» hat Charles Lewinsky auf spielerische Weise dem populistischen Zeitgeist auf den Puls gefühlt. Indem er die Geschichte bewusst in die Zukunft ansiedelte, schaffte er seiner Fantasie den nötigen Freiraum.
Zum Beispiel, dass die Parteiversammlungen der «ED» im Hallenstadion live vom Fernsehen übertragen werden. Dort verkünden die «Eidgenössischen Demokraten», dass sie die Todesstrafe einführen wollen. Sie haben auch den süffigen Slogan parat: «Kurz und schmerzlos ist nicht herzlos».
Wohltuend verzichtet Charles Lewinsky auf eine klassische Schwarz-Weiss-Malerei: Bei aller Überzeichnung bekommen doch alle ihr Fett ab.
Mit Kurt Weilemann ist ihm das Porträt eines mürrischen, frustrierten Pensionärs gelungen, der durch die Jagd nach den wahren Tätern endlich wieder Adrenalin in seinen Adern spürt. Denn der Alltag auf dem Abstellgleis des Ruhestandes setzt ihm arg zu, und er lässt keinen Zweifel offen: Altern ist demütigend.
Dieses Problem kenne er zum Glück nicht, lacht Charles Lewinsky. Als Schriftsteller könne er solange weiterschreiben wie es ihm passt. Jede Arbeit an einem neuen Buch sei auch für ihn selber mit vielen Überraschungen verbunden.
Seine Lust am Fabulieren ist beim Lesen spürbar und trägt viel zum Unterhaltungswert dieses Kriminalromans bei. Zurück bleibt trotzdem auch ein mulmiges Gefühl: Was wäre, wenn Lewinskys Szenario tatsächlich eines Tages Wirklichkeit werden würde?
Zurück zur Übersicht

