Glosse des Monats Februar
Schriftsteller bauen Luftschlösser, Leser wohnen darin, und Verleger ziehen die Miete ein.
Maxim Gorki

Sehr geehrter Herr Lewinsky,
Nachdem zu wiederholtem Mal Beschwerden über Sie bei der Buchverwaltung eingetroffen sind, sehen wir uns veranlasst, Sie an einige Bestimmungen der Leseordnung zu erinnern. Wir möchten Sie bitten, sich in Zukunft streng an diese Regeln zu halten, widrigenfalls wir uns gezwungen sehen würden, das zwischen uns abgeschlossene Lektüreverhältnis ausserterminlich zu beenden.
Sie sind mehrmals dabei beobachtet worden, wie Sie über Stellen gelacht haben, die ausser Ihnen niemand lustig gefunden hat. Im Interesse einer einvernehmlichen und gutnachbarlichen Lesegemeinschaft müssen wir Sie bitten, solche Heiterkeitsausbrüche in Zukunft zu unterlassen. Sie irritieren damit die anderen Nutzer des Buches, die dann vergeblich versuchen herauszufinden, was denn hier so komisch sein könnte.
(Alle unsere Bücher entsprechen den Regelungen der Arbeitsgemeinschaft für Normalhumor.)
Das Überblättern von Seiten verletzt die Gefühlswelt des Autors und könnte dazu führen, dass er im schlimmsten Fall Schmerzensgeld in der Form höherer Tantiemen von uns fordert. Sie werden sicher einsehen, dass eine bessere Bezahlung von Autoren sämtlichen seit Jahrhunderten eingeführten Geschäftsprinzipien eines Buchverlages widersprechen würde.
Das Anbringen von schriftlichen Anmerkungen am Rand der Seiten ist zwar prinzipiell zulässig, wir möchten sie aber aus gegebenem Anlass daran erinnern, dass solche Randbemerkungen nur mit Bleistift vorgenommen werden dürfen und bei Beendigung des Leseverhältnisses besenrein zu entfernen sind.
Ferner sehen wir uns gezwungen, Sie noch einmal mit Nachdruck darauf hinzuweisen, dass eine vorzeitige Beendigung des Lektürevorgangs vertragswidrig ist. Gemäß Leseordnung ist eine Unterbrechung von maximal zehn Tagen zulässig, danach muss das Werk zu Ende gelesen werden.
In diesem Zusammenhang müssen wir Sie auch bitten, im Interesse einer gedeihlichen Zusammenarbeit auf Ausrufe wie „Scheißbuch“ und „So ein Schrott“ in Zukunft zu verzichten. Bewertungen dieser Art bedürfen der Mitgliedschaft im Panel des „Literaturclubs“.
Und den Waschzettelschlüssel haben Sie auch nicht pünktlich weitergegeben.
Hochachtungsvoll
die Buchverwaltung
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 25. Februar 2018,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats März
Das Verlegen von Büchern wäre so viel einfacher ohne die Autoren.
Dan Brown

Wahrlich, ich sage euch: Der Tag wird kommen, an dem alle Bücher dieser Welt nur noch von Computern verfasst werden. Der Verleger wird gemütlich an seinem Schreibtisch sitzen und das gewünschte Genre, das angestrebte Zielpublikum und noch ein paar andere Parameter einprogrammieren (vor allem das Budget, das er für Werbemaßnahmen auszugeben bereit ist), und dann wird er ein Icon auf dem Bildschirm anklicken und zufrieden mit der geleisteten Arbeit in die Betriebskantine schlendern. Wo ihn schon sein Latte Macchiato erwarten wird, von einem anderen Computer exakt nach seinen persönlichen Vorlieben gebraut.
Genüsslich seinen Kaffee schlürfend und an einem nach seinen diätetischen Vorgaben frischgebackenen Keks knabbernd, wird er mit einem Kollegen über die Krise des Buchgeschäfts philosophieren, denn das wird sich als Einziges nicht verändert haben: Das Buchgeschäft wird auch in hundert Jahren in derselben Krise sein, über die die Verleger schon vor hundert Jahren gejammert haben.
Zurück in seinem Büro wird er das fertige Buch vorfinden, nicht nur geschrieben, sondern auch schon gedruckt, und dann wird er seinen Füller mit der roten Tinte in die Hand nehmen und das tun, was Verleger schon immer am liebsten getan haben: Er wird den Titel des Buches abändern.
(Schon der Verleger Johann Friedrich Cotta, so geht die Sage, soll Goethe den Vorschlag gemacht haben, seine „Italienische Reise“ doch lieber unter dem Titel „Amore und Spaghetti“ auf den Markt zu bringen.)
Dann wird der Verleger einen allerletzten Mausklick auf das Icon „Publizieren“ tun, und damit wird seine Arbeit erledigt sein. Nur der Tisch im besten Frankfurter Lokal, wo er während der Buchmesse auf den neusten Bestseller anstoßen will, bleibt noch zu bestellen, aber auch das besorgt das System selbsttätig.
Und wenn sie dann in Frankfurt zusammensitzen, satt vom Kaviar und voll vom Champagner, wird ein längst in den Ruhestand geschickter und nur noch gnadenhalber eingeladener Altverleger sein Glas heben, und sagen: „Trinken wir darauf, dass wir keine Autoren mehr brauchen!“
Und die andern in der Runde werden ihn verwundert ansehen und fragen: „Autoren – was ist das?“
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 25. März 2018,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats April
Schreiben ist nicht unbedingt etwas, dessen man sich schämen muss. Aber tu es, wenn du allein bist, und wasch dir nachher die Hände.
Robert Heinlein

Hör zu, mein Sohn, deine Mutter und ich finden, dass du jetzt in dem Alter bist, wo wir… Wo wir das Gespräch führen sollten, das auch mein Vater mit mir geführt hat, damals, als ich… Es ist nichts, dass einem peinlich sein müsste, aber…
Setz dich doch, mein Sohn.
Nein, es hat nichts mit Sex zu tun. Da wirst du dich ja auskennen, mit dem Internet und allem. Besser als ich vielleicht, hahaha.
Es geht um etwas Anderes, etwas, mit dem fast jeder Mensch einmal im Leben… Ich auch. Du wirst es nicht glauben, aber selbst dein Vater hat in deinem Alter… Sogar Gedichte.
Ja, davon rede ich. Ich finde es wichtig, dass du weisst… dass dir klar ist… dass wir einmal darüber geredet haben.
Nein, mein Sohn, ich bin noch nicht fertig. Deine Mutter hat in deinem Zimmer Spuren gefunden… Wie soll ich sagen? Spuren halt.
Handschriftliche.
Das ist nichts Schlimmes, überhaupt nicht. Fast jeder Mensch hat schon… Sogar ganz berühmte Leute.
Aber es war doch ein Schock für deine Mutter, dass sie so plötzlich… Es war halt eine Überraschung für sie, dass du schon in dem Alter bist, wo man… Du weisst ja: Wenn es nach den Müttern ginge, dürften ihre Kinder überhaupt nie erwachsen werden, hahaha. Mach nicht so ein ernstes Gesicht. Es macht dir ja niemand einen Vorwurf. Es überfällt einen manchmal einfach, das weiss ich aus eigener Erfahrung, und dann schreibt man eben.
Du musst überhaupt nicht rot werden. Das ist kein unanständiges Wort. Es wäre natürlich besser, wenn es eine lateinische Bezeichnung dafür gäbe, so wie bei… bei dieser anderen Sache. Aber „schreiben“ zu sagen ist völlig korrekt. Es ist sogar cool, wie ihr jungen Leute das nennt, hahaha.
Man kann auch „verfassen“ sagen oder „texten“. „Dichten“ würde ich nicht empfehlen, das ist mehr etwas für Mädchen.
Was ich dir sagen wollte, mein Sohn… was deine Mutter und ich dir sagen wollten: Es ist völlig in Ordnung, wenn du ab und zu schreibst. Nur nicht zu viel. Man wird nicht krank davon, wie manche Leute sagen, aber es lenkt von wichtigeren Dingen ab. Vom Fußball zum Beispiel. Schreib also ruhig. Aber tu es, wenn du allein bist, und wasch dir nachher die Hände.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 29. April 2018,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats Mai
Ironie ist die letzte Phase der Enttäuschung.
Anatole France
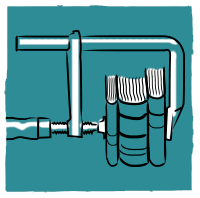
Man kann überall etwas über die Feinheiten der deutschen Sprache lernen. Sogar in einem Flugzeug, wo eigentlich nur Lektionen über das Einpassen von menschlichen Körpern in viel zu enge Sitze vorgesehen sind.
Es war auf einem dieser Flüge, auf denen einem wieder mal das volle Programm geboten wurde, von der Verspätung beim Abflug über den adipösen Sitznachbarn bis zum lautstark quengelnden Kleinkind. Ein Flug, auf dem Lesen völlig unmöglich war. Als wir uns dann endlich im Anflug auf Zürich befanden, ertönte über die Bordlautsprecher die zuckersüsse Ansage: „Wir hoffen, Sie haben Ihren Flug genossen.“ Und ich fing an nachzudenken.
Ich weiss, es ist für einen Menschen, der sich das Schreiben zum Beruf gemacht hat, ziemlich peinlich, das zugeben zu müssen, aber ich hatte mein ganzes Leben lang Mühe, „ironisch“ von „sarkastisch“ zu unterscheiden. Nie wusste ich genau, welches der beiden Adjektive gerade zutraf. Auch hier stellte sich mir die Frage: „Wenn die orwellsche Neusprech-Abteilung der Fluggesellschaft unschuldige Stewardessen dazu zwingt, vom Genuss eines Fluges zu schwafeln, wo es doch bestenfalls heissen dürfte „Wir hoffen, Sie haben Ihren Aufenthalt an Bord ohne bleibende Schäden überstanden“, wenn also das vollautomatische PR-Geschwafel eine Formulierung fern jeder Reise-Wirklichkeit produziert – ist das dann ironisch oder sarkastisch?
Ironie, sagt die Wikipedia, ist eine rhetorische Figur, mit der der Sprecher etwas behauptet, das seiner wahren Einstellung oder Überzeugung nicht entspricht. Das konnte in diesem Fall zutreffen, denn niemand, der bei einer Fluggesellschaft arbeitet, wird ernsthaft der Meinung sein, der Aufenthalt in solch einer fliegenden Sardinenbüchse habe irgendetwas mit Genuss zu tun.
Andererseits konnte es sich natürlich auch um Sarkasmus handeln, laut Wikipedia ein beissend bitterer Spott oder Hohn zwecks Kritik an gesellschaftlichen Zuständen.
Wie gesagt, bisher hatte ich die beiden Begriffe nie so richtig voneinander unterscheiden können. Aber während dieses Landeanflugs wurde mir klar: Die Lautsprecher-Hoffnung, man könnte diesen Flug genossen haben, ist weder ironisch noch sarkastisch. Sie ist ganz einfach nur zynisch.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 27. Mai 2018,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats Juni
Jede Widerstandsgeste ohne Risiko ist nichts als Geltungssucht.
Stefan Zweig
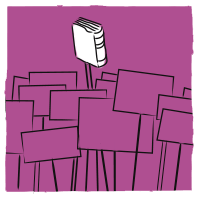
Manchmal frage ich mich, was ich eigentlich von Beruf bin: Schreiber oder Unterschreiber? Immer öfter werde ich gebeten, meinen Namen unter irgendeinen Aufruf, eine Petition oder einen öffentlichen Protest zu setzen. Ich folge diesen Einladungen sehr sparsam, weil ich der Meinung bin, dass man sich mit seinem Namen nur für Dinge einsetzen sollte, mit denen man sich tatsächlich befasst hat, und die einem ein wirkliches Anliegen sind.
Nicht alle meine Kollegen scheinen diese Auffassung zu teilen. Manche Namen trifft man auf solchen Listen so oft an, dass man sich fragt, wann diese Leute noch dazu kommen, Bücher zu schreiben, wo sie sich doch vierundzwanzig Stunden am Tag mit allen Problemen der Menschheit befassen müssen.
Denn man will doch nicht so misanthropisch sein und ihnen unterstellen, sie solidarisierten sich öffentlich mit Anliegen, deren Hintergründe sie gar nicht so genau kennten.
Oder sollte, wie Stefan Zweig behauptet, doch die Eitelkeit dabei eine Rolle spielen? Dann wäre so eine Unterschrift auch nicht viel anderes als die Louis-Vuitton-Tasche, mit deren Kauf sich manche Leute den Nimbus einer Modeikone zu erwerben hoffen. Nein, sich per Unterschrift über die Missstände in einem Land zu empören, das man ohne Google Maps nicht einmal auf der Landkarte finden würde, macht einen nicht zum politisch bewussten Menschen, sondern kennzeichnet einen nur als Adabei – um ein wunderschönes österreichisches Wort zu verwenden ‒, als jemanden, der auch dabei sein will. Weil es doch so schön ist, seinen Namen in repräsentativer Gesellschaft in der Zeitung zu lesen.
Warum werden gerade Schriftsteller so oft darum gebeten, ihren Namen auf solche Listen zu setzen? Ich vermute, es liegt an dem weitverbreiteten Missverständnis, das Mitglieder der schreibenden Zunft nur schon deshalb etwas zu sagen hätten, weil sie mit Worten umgehen können. Aber wir Schreiber sind – mit wenigen bewundernswerten Ausnahmen – nicht klüger andere Leute. Wir können unsere Stammtischweisheiten nur besser formulieren.
Aber man soll in solchen Dingen auch nicht stur sein. Eine Petition gegen das blinde Unterschreiben von Petitionen würde ich sofort unterschreiben.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 24. Juni 2018,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats Juli/August
Die Freundschaft eines großen Schriftstellers wäre eine große Wohltat. Es ist jammerschade, dass diejenigen, deren Gunst man sich wünscht, immer schon gestorben sind.
Jules Renard
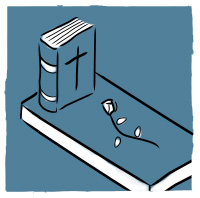
Ach, wissen Sie, mit den Freunden ist das so eine Sache. Friedrich Schiller zum Beispiel, ein netter Kerl, wirklich, wenn auch ein bisschen zu intellektuell für mich – aber muss er jedes Mal, wenn er mich besucht, ein Massband aus der Tasche holen und in meinem Bücherregal überprüfen, wer mehr Laufzentimeter hat, er oder Goethe?
Oder Balzac? Ein angenehmer Gast, eigentlich, auch wenn man alle fünf Minuten zur Kaffeemaschine laufen muss, um ihm den nächsten Espresso zu brauen. Aber ständig pumpt er einen an, hat zwischen zwei Besuchen jedes Mal neue Schulden gemacht und klagt die ganze Zeit über seine Deadlines, all die Romane, für die er schon Vorschüsse bezogen, aber noch nicht geschrieben hat. Und bittet schon wieder um den nächsten Kaffee.
Der charmanteste unter meinen Freunden kommt aus Italien. Ein ungeheuer liebenswerter Gesellschafter, gebildet und humorvoll, und wenn er aus seinen Memoiren vorliest, wird es immer richtig gemütlich. Nur:
Man darf auf keinen Fall Frauen dazu einladen, weil er ums Verrecken nicht einsehen will, dass das weibliche Geschlecht handfeste Zudringlichkeiten nicht schätzt, ob sie jetzt von ihm kommen oder von irgendeinem Hollywoodboss. Das will ihm einfach nicht in den Kopf, meinem Freund Giacomo Casanova.
Dafür ist Jeremias Gotthelf ein völlig unproblematischer Gast. Wenn er kommt, muss man eine DVD mit einem Franz-Schnyder-Film einlegen, und da sitzt er dann davor und sagt nur alle fünf Minuten: „So war es aber wirklich nicht, bei uns im Emmental.“ Übrigens: Er kommt immer nur unter der Woche vorbei. Am Sonntag muss er predigen.
Am angenehmsten ist mein Freund Willy Shakespeare, der so gern unanständige Witze erzählt und überhaupt nicht einsehen will, warum er ein Klassiker sein soll. Aber manchmal verstehe ich ihn einfach nicht, obwohl ich in Englisch immer gut war. Letzthin hatte ich ihn zum Essen eingeladen und das Steak, ich gebe es zu, war mir ein bisschen zäh geraten. Da hat er gesagt: „Hamlet, erster Akt, zweite Szene, Monolog.“ Keine Ahnung, was er damit meinte.
Ja, man hat es wirklich nicht immer leicht mit seinen Freunden. Vor allem, wenn sie tot sind.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 24. Juli 2018,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats September
Ich kenne Leute, die wissen, dass Strindberg Frauenhasser war und Grabbe ein Alkoholbesessener. (…) Von Hebbel wissen sie, dass er sich hässlich gegen eine Elise benommen hat, von Kleist, dass er Selbstmord beging, von Maupassant, dass er im Irrenhaus gestorben ist, und mit Goethes Verhalten Friederike Brion gegenüber sind sie nicht einverstanden. Aber sie kennen kein einziges Werk dieser Dichter.
Irmgard Keun
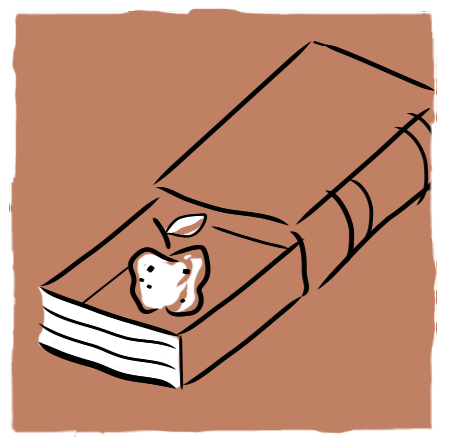 Ich habe Irmgard Keuns Worte in der Gesamtausgabe ihrer Werke gefunden, in der sich (Achtung, Werbung!) viele bisher unbekannte Texte dieser faszinierenden Autorin entdecken lassen.
Ich habe Irmgard Keuns Worte in der Gesamtausgabe ihrer Werke gefunden, in der sich (Achtung, Werbung!) viele bisher unbekannte Texte dieser faszinierenden Autorin entdecken lassen.
Es ist ja ein interessantes Phänomen, dass sich unser Wissen über Autoren oft auf einen einzigen Satz beschränkt. Ich selber, zum Beispiel, habe „Fascht e Familie“ geschrieben. Wenn ich irgendwo eine Lesung mache, geht die Leiterin der Bibliothek oder der Präsident des Kulturvereins vorher ans Mikrofon und teilt den Zuhörern mit: „Er hat ‚Fascht e Familie‘ geschrieben.“ Dann freuen sich alle und bereiten sich darauf vor, bei der Lesung viel zu lachen. Auch wenn es sich um ein ganz ernstes Buch handelt. Weil „Fascht e Familie“ doch lustig war. Manchmal – es passiert nicht jeden Tag, aber es passiert ‒ sprechen mich Leute auf der Strasse an, sind furchtbar nett zu mir und sagen: „Ich kenne jedes Wort, das Sie geschrieben haben.“ Und wenn ich sie dann frage, welches meiner Bücher ihnen am besten gefallen habe, dann ist es meistens die Episode, in der Walter Andreas Müller in Unterhosen dastand. Denn ich habe „Fascht e Familie“ geschrieben, und das ist es, was die Leute von mir wissen. So wie sie von Schiller wissen, dass er an faulen Äpfeln riechen musste, um inspiriert zu sein, oder von Nietzsche, dass er nie ohne Peitsche zum Weibe ging.
Ich weiss, man soll sich über seine Popularität freuen, aber andererseits…
Ich weiss nicht, ob ich wirklich glücklich sein werde, wenn man mir „Fascht e Familie“ auch noch auf den Grabstein meisselt. Oder wenn ich ans Himmelstor komme, und St. Petrus (oder wer immer für jüdische Frischverstorbene zuständig ist) sagt: „Sie sind doch der, der ‚Fascht e Familie‘ geschrieben hat.“ Und dann erzählt er mir – verständlich, dass ihm gerade die besonders gefallen hat – die Episode, in der Tante Martha in den Himmel kam.
Aber ich bin selber schuld. Ich hätte „Fascht e Familie“ eben nicht schreiben sollen.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 30. September 2018,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats Oktober
Jeder, der sich nicht für ein Genie hält, hat kein Talent.
Die Brüder Goncourt
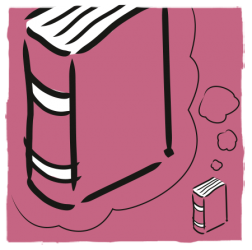
Um einen Roman zu schreiben sind nach meiner Erfahrung drei Zutaten unabdingbar: ein Computer, genügend Kaffee-Nachschub und Grössenwahn. Den Computer kann man eventuell durch Papier und Bleistift ersetzen oder auch – auf die Gefahr hin, als Hemingway-Imitator bezeichnet zu werden – durch eine antike Hermes Baby, und statt des Kaffees bevorzugen manche Kollegen alkoholische Getränke. Aber der Grössenwahn, darauf bestehe ich, ist für den Schriftstellerberuf unerlässlich.
Allerdings nur, wenn er keine Dauererscheinung ist. So ungern ich den brillanten Brüdern Concourt widerspreche: Wer sich jeden Tag schon beim Aufstehen für ein Genie hält, und an dieser Meinung auch noch festhält, wenn er am Abend unter die Decke kriecht, ist mit grosser Wahrscheinlichkeit völlig talentfrei. (Was ihn aber nicht stören wird, weil er es, vom Gefühl der eigenen Genialität völlig ausgefüllt, gar nicht bemerkt.)
Nein, die unerlässliche Zutat zum Schreiben eines Romans ist der punktuelle kreative Grössenwahn. Beim mühseligen Herumhirnen an dem zu schreibenden Buch muss irgendwann einmal der Gedanke aufblitzen: Das, was da gerade entsteht, ist wirklich brillant, einmalig und genau das, worauf die literarische Welt so lange gewartet hat. Und ich, dem das eingefallen ist, muss ein Genie sein.
Natürlich, dieses höchst angenehme Gefühl hält nie vor. Im Lauf der Arbeit zeigt sich sehr bald, dass einem das Aneinandermontieren von Worten keineswegs so leicht von der Hand geht, wie das bei einem Genie der Fall sein müsste. Und dass der Gedanke, der diesen so wohltuenden Grössenwahnschub ausgelöst hat, so einmalig brillant nun auch wieder nicht ist. Ganz brauchbar vielleicht oder auch ein bisschen mehr.
Aber ohne das kurzfristige High, das einem die irrtümliche Erkenntnis der eigenen Genialität vermittelt, würde sich niemand an die mühselige Arbeit machen, hunderte von Seiten mit Text zu füllen. Mein Textprogramm zeigt mir an, dass „Melnitz“ aus rund eins komma vier Millionen Zeichen besteht. So oft drückt niemand freiwillig eine Taste, wenn er nicht ab und zu, bei einem besonderen brillanten Einfall oder einer besonders hübsch gedrechselten Formulierung mit der Illusion belohnt wird, er sei ein Genie.
Und mit genügend Kaffee, selbstverständlich.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 28. Oktober 2018,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«

