Glosse des Monats Januar
Auch den Möbelpackern sind Leute, die Bücher lesen, zuwider. Aber sie haben wenigstens einen guten Grund dafür.
Gabriel Laub
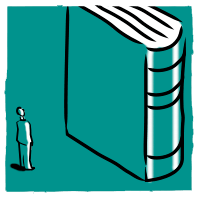
Früher habe ich immer gedacht, schwere Literatur, das sei Immanuel Kant oder Elfriede Jellinek. Jetzt weiss ich es besser. Denn ich habe ein Buch gekauft, das ist zu schwer für jede Lektüre. Zumindest kann man es nicht so lesen, wie man für gewöhnlich Bücher liest. Dafür ist der Band einfach zu gewichtig. Und zu gross. Der Postbote, der es bei mir ablieferte, liegt jetzt wahrscheinlich mit einem Rückenschaden im Spital und verflucht alle Verleger dieser Welt. Um ein Gedicht von Fontane zu variieren: „Ich hab es getragen sieben Sekunden, und ich kann es nicht tragen mehr.“ Ja, dieses Buch ist wahrlich schwere Literatur. Um es so zu lesen, wie ich es für gewöhnlich tue, bequem im Sessel hingefläzt, müsste man schon einen dieser buntbemalten Sessel haben, auf die sich, als ich ein Kind war, im Zirkus Knie die Elefanten setzten. Und im Bett geht es schon gar nicht. Wenn ich das wider alle Vernunft versuchte, würde man mich am nächsten Morgen tot auffinden, der Kriminalkommissar würde den Kopf schütteln und sagen: „Das ist das erste Mal, dass jemand von einem Buch erschlagen wurde.“ Schwere, schwere Literatur. Arnold Schwarzenegger könnte das Buch wahrscheinlich mit einer Hand halten. Aber dafür ist man bei ihm nicht sicher, ob er auch lesen kann. Im Englischen nennt man solche Ungetüme „Coffeetable books“, aber in unserer Wohnung findet sich kein Kaffeetischchen, das dieses Gewicht aushalten würde. Ich bin schon dankbar, dass wir im Parterre wohnen, so dass kein Nachbar unter uns von einem einstürzenden Fussboden begraben werden kann. Denn man kann dieses Buch nur lesen, wenn man sich dazu bäuchlings auf den Teppich legt und mit ausgestrecktem Arm eine Seite nach der anderen umblättert. Mit sehr lang ausgestrecktem Arm, denn das Buch ist nicht nur schwer, sondern auch gross. Obwohl es sich nicht um grosse Literatur handelt. Es ist ein Monstrum von einem Buch, ein Gulliver-Buch, ein lusus naturae literariae. Wenn mir ein paar nette Leute stemmen helfen, kann ich es vielleicht auf der Seite liegend ins Bücherregal packen. Allerdings müsste ich, um genügend Platz zu schaffen, dafür mindestens einen kompletten Brockhaus ins Antiquariat geben. Und ich weiss genau: Läge es einmal im Regal, ich würde es nie, nie wieder herausholen. Dafür ist es einfach zu schwere Literatur. Es handelt sich bei dem Buch übrigens um eine Produktion des Verlags Taschen. Es ist also ein Taschenbuch.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 31. Januar 2016,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats Februar
Sex ist nur schmutzig, wenn er richtig gemacht wird.
Woody Allen
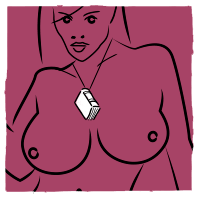
Viele Buchhandlungen klagen über schrumpfende Umsätze und führen das auf die Aufhebung der Buchpreisbindung zurück. Aber die bedauerliche Tatsache, dass nicht jeden Tag tausende von Kauflustigen die Buchläden stürmen, liegt sicher ebenso daran, dass die literarische Branche die Werbung sträflich vernachlässigt. Es soll ja tatsächlich Buchhändler geben, die meinen, eine intelligente Buchauswahl und fachkundige Beratung reichten aus, um Kunden anzuziehen. Das mag zu Goethes Zeiten so gewesen sein. Aber doch nicht mehr heutzutage!
Welche Automarke würde auch nur einen Wagen verkaufen, wenn sich am Autosalon nicht spärlich bekleidete Models auf den Kühlerhauben räkelten? Wie käme ein neues Glacé in den Markt, wenn es nicht auf einem Plakat von einer hübschen jungen Dame so lasziv zum Mund geführt würde, als sei die Abbildung einem Lehrbuch für Oralverkehr entnommen? Welche Zeitschriftentitel garantieren die höchsten Auflagen? Eben.
Sie verstehen, worauf ich hinaus will: Sex sells. Es kann doch wirklich nicht so schwer sein, liebe Buchhändler, dieses Prinzip auch in Ihrer Branche umzusetzen. Ein Anfang liesse sich schon einmal damit machen, dass man die Buchtitel ein bisschen attraktiver gestaltet – eben so, wie es zu unserer sexualisierten Gesellschaft passt. Ich hätte da ein paar bescheidene Vorschläge:
Wie wär’s mit einem Reclamband mit dem Titel „Die geschändete Jungfrau“, aus dem der Leser dann erfährt, was der sexsüchtige Doktor Faust mit dem unschuldigen Gretchen so alles anstellt? Und würde sich „Gullivers Reisen“ nicht zehnmal besser verkaufen, wenn der Titel lautete: „Der Mann, der den Grössten hatte“? Ganz zu schweigen vom Verkaufsschlager „In den Betten von Davos“, was doch einfach viel verkaufsträchtiger klingt als…
Genau, dieses Buch meine ich. Wirklich schade, dass Thomas Mann da nicht drauf gekommen ist.
Ja, selbst ein Ladenhüter wie eine tausend Seiten lange Biografie von Pfarrer Kneipp würde durch eine kleine Titeländerung sofort zum Renner. Man müsste das Buch einfach „Feuchte Träume“ nennen. Und wenn sich die Verlage querstellen sollten, dann bleibt wohl nichts anderes übrig, als sich doch den Automobilsalon zum Vorbild zu nehmen und das Outfit der Verkäuferinnen ein bisschen zu modernisieren. Liebe Buchhändlerinnen, ihr werdet doch wohl noch ein Bikini im Schrank haben?
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 28. Februar 2016,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats März
Gegenüber einem jüngeren Menschen kann man sich unsicher fühlen. Wie wollen wir denn heute wissen, ob er uns nicht in Zukunft übertreffen wird? Ist jedoch jemand inzwischen vierzig, fünfzig Jahre alt geworden und hat sich immer noch keinen Namen gemacht, dann braucht man vor ihm keine Scheu zu haben.
Konfuzius

Manchmal schreibt jemand sein allererstes Buch, und man denkt beim Lesen die ganze Zeit: Das kann doch nicht wirklich ein Erstlingswerk sein. Dazu schreibt der Mann viel zu perfekt. Zu souverän. Zu selbstsicher.
„Die Leiden des jungen Werthers“ (damals noch mit Genetiv-S) war so ein Erstlingsroman. Wahrscheinlich betraf die Selbstmordwelle, die das Buch ausgelöst haben soll, lauter Möchtegern-Autoren, die den Vergleich mit ihren eigenen bescheidenen Talenten nicht ertrugen.
Oder die „Buddenbrooks“. Ein gerade mal Sechsundzwanzigjähriger bringt sein erstes Buch heraus, und schon schreibt Rainer Maria Rilke in einer Besprechung: „Man wird sich diesen Namen unbedingt notieren müssen.“
Manchmal sind solche Erstlingsautoren nicht nur unverschämt gut, sondern auch unverschämt jung. Der Débutroman von Benjamin Lebert – Millionenauflage, in mehr als dreissig Sprachen übersetzt ‒ erschien, als der Autor noch nicht einmal den Autoführerschein machen durfte. Kein Wunder heisst der Titel „Crazy“.
Im Normalfall allerdings verläuft der Entwicklungsweg eines Schriftstellers weniger steil. Das erste Buch ist meistens noch mit unverdauten Empfindungen überladen, beim zweiten scheint vielen Autoren bereits der Stoff auszugehen, und erst mit dem dritten oder vierten entwickelt sich die handwerkliche Sicherheit, die zum Schreiben eben auch gehört.
Ausser bei jenen Glückskindern, die das alles nicht nötig zu haben scheinen.
Gerade habe ich wieder so ein Buch gelesen. Sein Verfasser ist zwar kein Teenager mehr, aber doch erst gerade so alt wie mein Sohn, und er versichert glaubhaft, dies sei tatsächlich ein Erstlingswerk. Dabei hat er die Stilsicherheit eines erfahrenen Schreibers, spürt mit professioneller Präzision, wann seine Geschichte einen Szenenwechsel braucht, und weiss Pointen zu setzen, dass man aus dem Staunen nicht herauskommt.
Entweder hat dieser Autor schon ein halbes Dutzend Romane unter Pseudonym verfasst, oder die Muse hat sich einfach in ihn verliebt. Wenn er nicht so sympathisch wäre, würde ich neidisch auf ihn werden.
Ach ja: Er heisst Emanuel Bergmann und sein Buch „Der Trick“. Sie sollten es lesen.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 27. März 2016,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats April
Es wäre gut, Bücher zu kaufen, wenn man die Zeit, sie zu lesen, mitkaufen könnte.
Arthur Schopenhauer
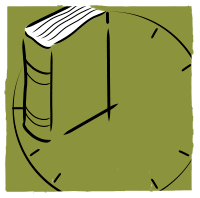
Goethes sämtliche Werke? Ja natürlich, haben wir vorrätig. Zum Lesen oder zum ins Regal stellen? Doch, das macht preislich einen grossen Unterschied. Zumindest, wenn sie die Lesezeit gleich mitkaufen wollen. Beim so einem Klassiker geht das ganz schön ins Geld.
Ach so, ein Matura-Geschenk für Ihren Göttibuben! Da sind zehn Minuten Lesezeit für den ganzen Goethe mehr als genug. Er wird die Bücher sowieso bei E-Bay verhökern, und die Zeit braucht er nur, um die Gebrauchsanweisung für das Videogame zu studieren, das er sich von dem Geld kaufen wird.
Was sollen es denn für Minuten sein?
Nein, die sind nicht alle gleich. Den Goethe gibt es ja schliesslich auch nicht nur in einer Ausgabe. Wir haben ihn in Leder oder in Halbleinen oder als Taschenbuch. Ich zeig Ihnen gern mal unser Zeit-Sortiment.
Hier zum Beispiel, ein echtes Schweizer Produkt: originale Schneider-Ammann-Sekunden. Sehr sparsam im Verbrauch. Wenn sie die beim Lesen verwenden, kommt ihnen jede Minute vor wie eine halbe Stunde.
Oder hier, speziell für Klassikliebhaber, etwas ganz Exklusives: garantiert echte Altphilologen-Sekunden. Mit denen verstehen Sie plötzlich jedes griechische Zitat.
Oder unser Sonderangebot zum Frühling:
Jungmädchen-Sekunden. Ideal für Romane, in denen rosarote Einhörner die Hauptrolle spielen. Obwohl, dazu würde ich Ihnen nicht raten. Die sind alle von Fünfzehnjährigen gewonnen, und als Nebenwirkung kann sich leicht mal Akne einstellen.
Dafür ist das hier etwas ganz Tolles! Vor allem bei Leuten sehr beliebt, die viel Eisenbahn fahren müssen: Legastheniker-Sekunden. Wenn Sie die verwenden, können Sie zum ersten Mal „20 Minuten“ lesen und tatsächlich zwanzig Minuten dafür brauchen.
Teuer? Kann ich nicht finden. Sie müssen bedenken, dass wir hier keine Billigsekunden verkaufen, wie das manche Discounter tun. Was den Kunden da manchmal für Schund angedreht wird, seit die Lesezeit-Preisbindung aufgehoben wurde! Massenware von dubiosen chinesischen Zwischenhändlern, und auf der Verpackung steht nicht einmal der Vorbesitzer vermerkt. Da kauft sich dann einer einen Band Heidegger und kriegt dazu Minuten geliefert, die sich höchstens für „Shades of Grey“ eignen würden.
Sie wollen es sich noch einmal überlegen? Gern. Aber brauchen Sie nicht zu viel Zeit dafür. Das kann ganz schön ins Geld gehen.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 24. April 2016,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats Mai
Worte sind wild, frei, unverantwortlich und nicht zu lehren. Natürlich kann man sie einfangen, einsortieren und sie in alphabetischer Reihenfolge in Wörterbücher stecken. Aber dort leben sie nicht.
Virginia Woolf

Liebe Frau Meier,
Sie heissen anders, aber ich will Sie mit dieser öffentlichen Antwort nicht ausstellen. Sie sind ja auch nicht die einzige, von der ich manchmal solche Post bekomme.
Sie haben mir geschrieben, weil sie ein Wort in einem Buch von mir so unerträglich fanden, dass Sie gar nicht mehr weiterlesen konnten. „Ich musste“, hiess es in Ihrem Brief, „nachdem ich diesen Satz gelesen habe, erstmal schlucken und das Buch weglegen.“
Um welchen Satz ging es dabei? In „Melnitz“ gehen zwei Frauen im Jahre 1937 in ein Variété. Und was steht dort für ein Orchester auf der Bühne? „Zwölf Mann in Glitzerjacketts, drei Saxophone, und am Schlagzeug ein Neger mit einem breiten weißen Grinsen.“ Es waren nicht die Glitzerjacketts, die Sie gestört haben und auch nicht die Saxophone. Es war der Neger. Man dürfe dieses Wort, schreiben Sie, „nicht mehr als Beschreibung schwarzer Menschen gebrauchen.“
Welches Wort hätte ich Ihrer Meinung nach sonst verwenden sollen – in einer Szene, die in den dreissiger Jahren spielt? Der „Afroamerikaner“ war damals noch nicht erfunden. Hätte ich also „dunkelhäutig“ schreiben müssen? Oder, wie Sie das tun: „schwarzer Mensch“? Das würde von mehr Feingefühl als Sprachgefühl zeugen.
Und hätte ich, um Ihre Kritik logisch weiterzuspinnen, in diesem Roman über eine jüdische Familie in der Schweiz dann nicht auch das Wort „Jude“ vermeiden sollen? Wäre es nicht besser gewesen, wenn ich den Viehhändler Salomon Meijer als „Sohn jüdischer Eltern“ bezeichnet hätte, so wie es manche Journalisten in vorauseilendem Gehorsam tun? (Mir fallen nur zwei Persönlichkeiten ein, bei denen diese Formulierung Sinn gemacht hätte. Der eine war der katholische Kardinal Lustiger. Der andere hiess Jesus Christus.)
Nein, liebe Frau Meier, man macht die Welt nicht besser, in dem man sie umformuliert. Unsere feinsinnige politische Korrektheit mit in ihrem krampfhaften Bemühen, belastete Worte zu vermeiden, ist oft nur lächerlich. So lächerlich wie die „Unaussprechlichen“, wie hochmoralische viktorianische Damen ganz gewöhnliche Hosen bezeichneten.
Habe ich Sie jetzt verletzt? Das war nicht der Zweck dieser Zeilen. Aber wenn es so sein sollte, kann ich mir nicht verkneifen, Ihnen zu raten: Trösten Sie sich doch mit einem Mohrenkopf. Oder, wenn Ihnen das lieber ist, mit einer Süssspeise mit Migrationshintergrund.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 29. Mai 2016,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats Juni
Wenn du nicht weisst, was als nächstes passiert, hast du eine gute Chance, dass es der Leser auch nicht erraten kann.
Stephen King
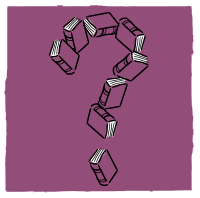
Ein kleines Sonntags-Quiz zu den frischen Gipfeli und dem Orangensaft: Wer hat den Cliffhanger erfunden?
Sie wissen schon, was ich meine: diesen Erzählertrick, seinen Helden zum Schluss eines Buchkapitels, einer Filmszene oder einer Serienepisode in eine scheinbar so aussichtslose Situation zu bringen, dass der Leser (oder Zuschauer) unbedingt wissen will, wie die Geschichte weitergeht. Und deshalb weiterliest oder die nächste Folge der Serie einschaltet.
Also, wer war’s?
a) Edgar Wallace, auf dessen Buchumschlägen stand, es sei unmöglich, von ihm nicht gefesselt zu werden?
b) The master of suspense Alfred Hitchcock?
Oder c) jemand ganz anderes?
Wenn Sie Antwort c angekreuzt haben, sind Sie schon mal in der nächsten Runde und haben, wie es in Werbeflyern immer so schön heisst, die Chance, den Hauptpreis zu gewinnen. Sie müssen dazu noch nicht einmal eine Rheumadecke bestellen, sondern nur den Namen des tatsächlichen Erfinders dieses literarischen Tricks nennen. Und das Erscheinungsjahr des allerersten Cliffhangers.
Es war überraschenderweise schon 1873, und es hing jemand ganz wörtlich an einer Klippe.
Der englische Autor Thomas Hardy hatte den Auftrag angenommen, für die Zeitschrift Tinsleys’s Magazine einen Fortsetzungsroman zu schreiben. Er hiess A Pair of Blue Eyes, und am Ende eines Kapitels liess Hardy seinen Helden über den Rand einer Klippe stolpern und nur noch an den Fingerspitzen über dem Abgrund hängen.
(Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe von Tinsley’s Magazine. Wenn Sie noch nicht Abonnent sind, sollten Sie es dringend werden.)
Wie im braven viktorianischen Zeitalter gar nicht anders möglich: Einen Monat später wurde der Held am Anfang des nächsten Kapitels gerettet. Man hätte diesen glücklichen Ausgang schon an seinem Namen ablesen können. Kein Autor der Welt lässt eine Figur mit dem schönen Namen Knight vor dem Happy End wegsterben. (Die Heldin, die ihn rettet, hiess übrigens Elfride. Ohne i-e.)
Thomas Hardy schrieb vierzehn Romane, jede Menge Kurzgeschichten und an die tausend Gedichte. Aber die literarische Unsterblichkeit und einen Platz im Wörterbuch hat er sich mit einer einzigen Szene gesichert, eben mit dem originalen Cliffhanger.
Wenn Sie es gewusst haben, haben Sie folgenden wertvollen Preis gewonnen:
(Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe von Bücher am Sonntag. Wenn Sie also noch nicht Abonnent sind…)
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 26. Juni 2016,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats Juli
Wenn Köchinnen zusammenkommen, sprechen sie von ihrer Herrschaft, und wenn deutsche Schriftsteller zusammenkommen, sprechen sie von ihren Verlegern.
Heinrich Heine

„…also meiner, weisst du, meiner will immer wieder dasselbe gekocht haben. Bloss weil es bei den Gästen einmal gut angekommen ist. Verlangt immer das exakt gleiche Rezept von mir. Und dann wundert er sich, wenn es mir beim Kochen langweilig wird.“
„Ja, das kenne ich auch. Und wenn den Kunden der dritte Aufguss dann nicht schmeckt, machen sie einem Vorwürfe und sagen: ‚Man darf den Leuten eben nicht jedes Mal dasselbe servieren.‘“
„Sie wissen einfach nicht, was sie wollen.“
„Doch: möglichst viel Umsatz.“
„Das ist ja das Schlimme: Zahlen können sie lesen, aber von wahrer Kochkunst haben sie keine Ahnung.“
„Sonst würden sie sich ja selber an den Herd stellen. Aber ein Eunuch weiss eben auch nur theoretisch, wie man Kinder zeugt.“
„Höhöhöhö.“
„Lacht nicht so laut, um Himmelswillen! Wenn sie uns hören, schmeissen sie uns raus. Und wenn man schon endlich einmal eine Herrschaft gefunden hat…“
„Ach was, sie brauchen uns mehr als wir sie. Was wollen sie den Leuten denn servieren, ohne uns? Bei den unverlangt eingesandten Kostproben ist doch nie etwas Essbares dabei.“
„Wenn sie wenigstens dankbar dafür wären, dass wir in ihrer Küche stehen! Aber wenn ein Gericht einmal so gut ankommt, dass man es kaum schafft, all die bestellten Portionen rechtzeitig auszuliefern, dann glauben sie doch tatsächlich, sie seien selber an dem Erfolg schuld.“
„Klar. Die Leute gehen ja auch wegen dem Klavierstimmer ins Konzert.“
„Wegen des Klavierstimmers.“
„Jetzt fang nicht auch noch an wie meine Herrschaft!“
„Meiner meint doch tatsächlich, meine letzte Kreation sei nur deshalb so erfolgreich geworden, weil er so viel Werbung, dafür gemacht habe!“
„Sie überschätzen sich total. Meinen alles besser zu wissen als wir Kochkünstler.“
„Ich habe eine tolle Methode, damit mir meiner nicht reinredet: Ich schlage für eine neue Kreation immer einen völlig unmöglichen Namen vor. Dann ist er ein paar Wochen lang so damit beschäftigt, mir den auszureden, dass er gar nicht mehr dazu kommt, sich bei den Zutaten einzumischen.“
„Aber wisst ihr, wer noch viel lästiger ist als alle Herrschaften zusammen?“
Alle, im Chor: „Die Gastrokritiker!“
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 27. August 2016,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats August/September
„Wie lange braucht man, um ein Buch zu schreiben?“
„Das kommt darauf an.“
„Worauf?“
„Auf alles.“
Joël Dicker
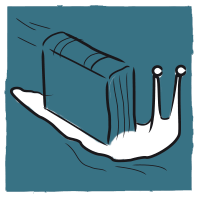
Georges Simenon verfasste 193 Romane und 167 Erzählungen. Und das sind nur diejenigen, die er unter seinem eigenen Namen veröffentlichte. Unter verschiedenen Pseudonymen kommen noch etwa 200 weitere Romane dazu. Er soll, so erzählte er selber, für ein Buch selten mehr als vierzehn Tage gebraucht haben. (Um eine Frau zu erobern und wieder zu verlassen, sagt man, brauchte er noch weniger Zeit.)
Robert Musil hinwiederum arbeitete am „Mann ohne Eigenschaften“ einundzwanzig Jahre lang. Er starb, ohne den Roman vollendet zu haben.
Natürlich, man soll literarische Werke nicht miteinander vergleichen. (Nicht, dass sie alle unvergleichlich wären. Es wird mir wohl niemand widersprechen, wenn ich behaupte, dass „Buddenbrooks“ ein besseres Buch ist als „Suche impotenten Mann fürs Leben“.) Aber ich stelle mir doch manchmal die Frage: Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit des Schreibprozesses und der Qualität des Produkts?
Ich persönlich wäre dankbar, wenn langsames Schreiben immer auch besseres Schreiben bedeutete. Es wäre ein schöner Trost an all den mühseligen Tagen, an denen man sich jedes Wort einzeln aus den Fingern saugen muss, nur um am Abend die wenigen Sätze, die man geschafft hat, mit der Delete-Taste in den Literatur-Orkus zu schicken.
Andererseits… Dass es mit einem Text so überhaupt nicht vorwärts gehen will, könnte ja auch einfach bedeuten, dass man diesen Text besser überhaupt nicht schreiben sollte. Weil einen die Muse nicht küssen kann, wenn sie sich gleichzeitig die Nase zuhalten muss.
Und nochmal andererseits… Wenn es läuft wie geschmiert – doch, auch das kommt durchaus mal vor –, bedeutet das dann nicht, dass man eigentlich gar nicht schreibt, sondern eben nur schmiert?
Und ein drittes Mal andererseits… Ben Jonson berichtet über William Shakespeare, wenn der seine Dramen verfasst habe, „he never blotted out a line“. Der grösste aller Theaterautoren war also ein Schnellschreiber, der immer gleich mit der ersten Textfassung zufrieden war. Sollte man angesichts seiner Meisterwerke nicht versuchen, seinem Vorbild zu folgen?
Die Frage nach dem richtigen Schreibtempo wird sich wohl nie beantworten lassen. Aber es wäre schön, wenn mal jemand ein Buch darüber schreiben würde. Ob schnell oder langsam – das ist mir völlig egal.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 25. September 2016,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats Oktober
Der Kaffee kommt im Magen an, und sofort beginnt eine allgemeine Aufregung. Ideen setzen sich in Marsch, wie die Bataillone der Grande Armée auf einem Feldzug, und die Schlacht beginnt. Erinnerungen kommen in vollem Galopp angeritten, schnell wie der Wind. Die leichte Kavallerie der Vergleiche liefert eine prächtige Attacke, die Artillerie der Logik eilt samt Train und Munition herbei, die Geschosse der Pointen schlagen ein wie aus der Hand von Scharfschützen.
Honoré de Balzac

Ach, nicht einmal auf einen Klassiker wie Balzac ist Verlass.
Als ich sechzehn war und mich für einen Dichter hielt (als ich sechzehn war, hielt sich jeder für einen Dichter, der einen schwarzen Rollkragenpullover besass und seine Gauloise ohne Filter rauchte), als ich ein pickliger, übergewichtiger Teenager war (auch wenn man das Wort noch gar nicht kannte und hoffte als revoluzzender Halbstarker zu gelten, obwohl man doch furchtbar kleinbürgerlich war), als ich, um den Satz endlich zu Ende zu bringen, in jugendlichem Grössenwahn davon überzeugt war, für die Literatur bestimmt zu sein, da kochte ich mir eines Nachts einen grossen Topf extrastarken Kaffee, legte einen Stapel Schreibpapier bereit und wartete auf die Inspiration. Ich wusste schliesslich, dass wahre Dichter nur in finsterer Nacht schreiben, von zahllosen Tassen Kaffee und mindestens zwei Packungen Zigaretten wach gehalten. Balzac, so hatte ich gelesen, trank jeden Tag so viele Tassen Espresso, dass Starbucks für ihn eine eigene Filiale eröffnet haben würde. Wobei es Starbucks damals noch gar nicht gab. Zu seiner Zeit war noch nicht einmal Schiffssteuermann Starbuck mit Käpt‘n Ahab auf die Jagd nach Moby Dick gegangen. Ich trank also eine Tasse Kaffee und noch eine, rauchte eine Zigarette und noch eine, aber die so sehnlichst erwartete Muse wollte sich einfach nicht einstellen. Als die Nacht zu Ende war, hatte ich kein unsterbliches Meisterwerk verfasst, sondern mir nur von den zu vielen Zigaretten Kopfschmerzen eingehandelt. Sowie (davon hatte bei Balzac nichts gestanden) einen gewaltigen Durchfall vom übermässigen Kaffeetrinken. „On The Loo“ statt „On The Road“. Seither versuche ich, meine Arbeit als Schriftsteller ohne Aufputschmittel zu tun. Na ja, fast immer.
Denn so ein Espresso zwischendurch tut manchmal schon gut. Oder auch zwei.
Es können ruhig auch doppelte sein.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 30. Oktober 2016,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«

