Glosse des Monats Januar
Es gibt keine wirklichen Hassgefühle ausser den literarischen. Politische Hassgefühle sind gar nichts.
Victor Hugo

Natürlich, Hass ist kein schöner Zug, auch nicht bei Schriftstellern. Aber Literaten wissen ihre Gemeinheiten wenigstens so brillant zu formulieren, dass selbst stammtischerprobte Politiker nur in den seltensten Fällen mithalten können. Nur Winston Churchill war auch in dieser Hinsicht meisterhaft. Vielleicht hat er ja seinen Nobelpreis deshalb in der Sparte Literatur bekommen.
Die Abneigung, die zu diesen kunstvoll mit Vitriol getränkten Gemeinheiten führt, muss nicht immer einen Grund haben. Nur manchmal kann man sich erklären, wo sie herkommt. Wer – um ein Beispiel aus der deutschen Klassik anzuführen – immer nur als biederer Handwerker der Literatur wahrgenommen wird, so wie es August von Kotzebue sein Leben lang erging, der kann einen umjubelten Grossdichter wie den Geheimrat Goethe ja nicht mögen. Vor allem nicht, wenn der die Finanzen seines Weimarer Theaters immer wieder mit den Kassenerfolgen des verachteten Konkurrenten saniert, und ihn trotzdem nicht gebührend schätzt. Aus Rache verfasste Kotzebue dann einmal eine schonungslose Kritik mit dem wunderbaren Titel: „Beweis, dass Herr von Göthe kein Deutsch versteht“.
Bei anderen lassen sich die Hassgefühle nicht so leicht erklären. Aber man kann sich trotzdem an der Eleganz erfreuen, mit der sie ausgedrückt werden. Ich weiss nicht, was Virginia Woolf gegen James Joyce hatte, aber ich bewundere die sprachliche Eleganz, mit der sie ihre Abneigung zu Papier brachte: „‚Ulysses‘ ist die Arbeit eines überempfindlichen Studenten, der sich seine Pickel kratzt.“
Und auch Vladimir Nabokovs Freud-Beschimpfung ist – Wie könnte es bei Nabokov anders sein? – meisterhaft formuliert: “Ich finde ihn plump, ich finde ihn mittelalterlich, und ich will nicht, dass ein älterer, mit einem Regenschirm bewaffneter Herr aus Wien uns seine Träume aufzwingt.“
Oder Gore Vidal über Aleksandr Solshenitsyn: „Er ist ein schlechter Schriftsteller und ein Dummkopf. Diese Kombination macht einen für gewöhnlich in den USA sehr populär.“
Meine absolute Lieblingsbosheit aber stammt vom genialen Übersetzer Harry Rowohlt, der den von ihm nicht geschätzten Albert Camus gewissermassen mit einem trockenen linken Haken erledigte. Nämlich mit der Formulierung: „Ein zu Unrecht unvergessener Autor.“
Alles sehr unhöflich, meine Damen und Herren. Aber geben wir es zu: Die Politiker kommen da nicht mit.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 25. Januar 2015,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats Februar
Noch kein Glücklicher hat je ein gutes Buch geschrieben.
Arno Schmidt
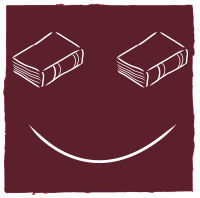
Ich habe noch nie ein gutes Buch geschrieben. Nur Schrott und Plunder habe ich produziert, ungeeignet für anständige Bücherregale, bestenfalls für die Papierabfuhr bestimmt. Manchmal, ich kann mir den Grund auch nicht erklären, sind Leser und Kritiker auf das sprachliche Blendwerk hereingefallen, das ich mit der Tastatur meines Computers zu produzieren pflege, aber wirklich gut waren die Bücher nicht. Sie konnten es gar nicht sein.
Denn (empfindsame Gemüter mögen bitte weghören und die nächsten Zeilen überspringen) denn ich bin eigentlich ein ganz glücklicher Mensch. Seit fast einem halben Jahrhundert bin ich mit derselben Frau zusammen, und es passiert mir immer noch, dass mein Herz bei ihrem Anblick ins verliebte Wummern gerät. Ich habe zwei wunderbare Kinder, auf die ich furchtbar stolz wäre, wenn ich nicht wüsste, dass ihre Leistungen ihr eigenes Werk sind, zu dem ich selber nur sehr wenig beitragen konnte. Und die nächste Generation lässt sich auch sehr vielversprechend an.
Ausserdem, und ich weiss, dass man das eigentlich nicht zugeben sollte, wenn man ein ernstzunehmender Künstler sein will, ausserdem (empfindsame Leser bitte schon wieder weghören und erst später weiterlesen), ausserdem macht mir mein Beruf Spass. Ich schreibe gern und würde es wohl auch tun, wenn mich niemand dafür bezahlte. Umso erfreulicher, dass mir mein Verleger jedes Jahr eine Abrechnung schickt, die mir nicht nur das tägliche Brot finanziert, sondern auch noch die Butter obendrauf. Und ab und zu ein Scheibchen Lachs.
Wenn man schon mal am Beichten ist, soll man es gründlich tun. Also streue ich hiermit Asche auf mein Haupt und gestehe: Wenn ich mich jeden Morgen pünktlich um neun Uhr an meinen Computer setze (genauer gesagt: um zehn vor neun, denn das Kreuzworträtsel aus der Washington Post will noch vor Arbeitsbeginn gelöst sein), dann fühle ich mich keineswegs als Galeerensklave, den die Peitschenhiebe eines sadistischen Aufsehers ans Ruder zwingen, sondern freue mich auf die Überraschungen, die mir das Schreiben immer wieder neu beschert.
Selbst wenn die AutorInnnen der Schweiz mich für diese Tatsache aus ihren Reihen ausschliessen: Ich leide noch nicht einmal an Depressionen.
Und darum habe ich eben noch nie ein gutes Buch geschrieben.
Aber vielleicht irrt sich Arno Schmidt ja auch.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 22. Februar 2015,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats März
Nachahmung fremder Eigenschaften und Eigentümlichkeiten ist viel schimpflicher als das Tragen fremder Kleider: denn es ist das Urteil der eigenen Wertlosigkeit, von sich selbst ausgesprochen.
Arthur Schopenhauer

Wenn Sie, wie ich, die NZZ am Sonntag am liebsten beim gemütlichen Sonntags-Brunch lesen, dann haben Sie jetzt bestimmt auch Zeit für ein kleines Quiz.
Also dann: Welchen der folgenden Buchtitel gibt es nicht wirklich, und ich habe ihn nur zum Zweck dieser Glosse erfunden?
a) „Die alte Dame, die ihren Hut nahm und untertauchte“;
b) „Der 50-jährige, der nach Indien fuhr und über den Sinn des Lebens stolperte“;
c) „Der Schriftsteller, der dachte, sein Roman würde sich besser verkaufen, wenn er auch wie alle andern einen Relativsatz in den Buchtitel einbaute“.
Na?
Ich wünschte ja, alle drei Titel wären nur Ausgeburten meiner kranken Fantasie, aber die ersten beiden liegen tatsächlich in den Buchhandlungen. Die „Relativsatz im Titel“-Seuche ist ausgebrochen und bis jetzt hat die Wissenschaft noch kein Heilmittel dagegen zu gefunden.
Die Typhoid Mary dieser Epidemie, also derjenige, der alle andern angesteckt hat, war wohl der schwedische Autor Jonas Jonasson. Wenn er gewusst hätte, was für Folgen das haben würde, hätte er seinen sympathischen Erstlingsroman vielleicht gar nicht geschrieben. Oder er hätte ihn anders genannt.
„Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“ wurde ein internationaler Grosserfolg. Und das Nachfolgebuch, „Die Analphabetin, die rechnen konnte“, verkauft sich auch nicht schlecht.
Seither ist das Virus nicht zu stoppen.
In den Verlagen gibt es wahrscheinlich schon eigene Spezialisten, die nichts zu tun haben als die Titelvorschläge der hauseigenen Autoren zu verrelativsatzen. „Wie soll ihr Büchlein heissen, Herr Goethe? ‚Die Leiden des jungen Werther‘? Da müssen wir schon noch etwas dran tun, wenn die Buchhändler ihr Werk direkt neben die Kasse legen sollen.“
Und, wer weiss, vielleicht hätte ja „Der Werther, der zu jung war und daran litt“ noch viel mehr Erfolg gehabt. Vielleicht hätten sich nach der Lektüre auch nicht liebeskranke junge Leute reihenweise umgebracht, sondern nur feinsinnige Ästheten, die es nicht ertragen, wenn eine so sinnlose Modewelle die Titelliste der Neuerscheinungen überrollt.
PS: Vielleicht ist ja auch Oliver Sacks an allem schuld. Er schrieb „Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte“. Aber Sacks ist wenigstens Arzt und weiss, dass das Ganze eine Seuche ist.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 29. März 2015,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats April
Mit den Gedanken ist es wie mit den Melodien, es gibt die kurzen, geringen – und die langen, schönen; die besten aber sind wie Kugelblitze und enthalten die Welt im Ganzen.
Hugo von Hofmannsthal
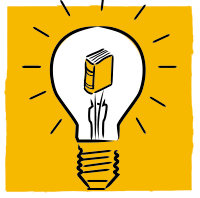
Letzte Warnung:
Wenn mich noch einmal, und sei es nur ein einziges Mal, jemand fragt, wo ich denn meine Ideen hernehme, dann werde ich anfangen zu schreien. Wenn es jemand tut, der selber von Ideen lebt und es deshalb besser wissen müsste, werde ich sogar würgen. Und wenn es wieder mal ein Kulturjournalist ist, der mir die Frage stellt, werde ich ihm die Kehle aufschlitzen und mit seinem Blut die einzige Antwort an die Wand schreiben, die es auf diese Frage geben kann: Ich weiss es nicht.
ICH WEISS ES NICHT!
ICH WEISS ES NICHT!
Und ich bin sicher: Wenn ich dann wegen Mordes vor Gericht stehe, wird man mir mildernde Umstände zubilligen. „Als man ihm die Frage zum hundertsten Mal stellte“, wird mein Verteidiger sagen, „da ist er noch ganz friedlich geblieben. Beim fünfhundertsten Mal“, wird er sagen, „ist er schweigend aus dem Saal gegangen und hat erst auf der Strasse angefangen zu toben. Aber beim tausendsten Mal…“
Und der Richter wird verständnisvoll mit dem Kopf nicken. „Notwehr“, wird er sagen. „Die ganz natürliche Reaktion auf eine unerträgliche Provokation.“ Und dann wird er mich, damit dem Gesetz Genüge getan ist, zu einer Geldbusse von zwei Franken fünfzig verurteilen. Und die wird er mir erst noch leihen.
Denn wir wissen nun mal nicht, wo wir unsere Ideen her haben. Und noch schlimmer: Wir wollen es gar nicht wissen. Wir haben sogar Angst, uns nur Gedanken darüber zu machen. Es könnte sonst passieren, dass wir nie mehr welche haben. Ein Tausendfüssler darf auch nicht darüber nachdenken, in welcher Reihenfolge er seine Beine auf den Boden stellt. Weil er sonst nur noch dauernd auf der Schnauze landet.
(Falls Tausendfüssler etwas haben, das man als Schnauze bezeichnen kann.)
Hat die Auster notiert, wann das Sandkorn angespült wurde, aus dem sie Jahre später eine Perle machte?
Weiss der Hund, in welcher Sekunde ihn der Floh gebissen hat?
Können Sie haargenau sagen, wo Sie sich Ihren Schnupfen eingefangen haben?
Wir wissen es nicht.
Deshalb, bitte, bitte, bitte: Wenn Sie zu einer Lesung kommen und Ihnen jemand das Mikrofon für die Fragen aus dem Publikum reicht, fragen Sie mich nicht, wo ich meine Ideen her habe. Ich schreie so ungern. Und würgen macht mir schon gar keinen Spass.
(Anmerkung der Redaktion: Das war wieder eine lustige Glosse, Herr Lewinsky. Wo nehmen Sie bloß die Ideen her?)
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 26. April 2015,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats Mai
Intelligente Fehler zu machen, ist eine große Kunst.
Federico Fellini
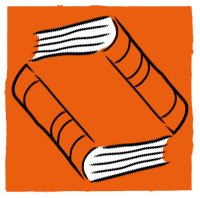
Die Grammatik hat ihre strengen Regeln, und die Orthographie regiert mit dem katholischen Anspruch allgemeiner Gültigkeit. (Was heute nicht mehr ganz funktioniert, weil sie zu oft reformiert wurde.) Was so nicht im Duden steht, wird von jedem Korrektor erbarmungslos ausgemerzt. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf.
Und dabei sind es doch oft die scheinbaren Fehler, die unserer Sprache Glanzlichter aufsetzen. Vorausgesetzt sie werden von jemandem begangen, der die Sprache wirklich beherrscht. Wer nicht perfekt reiten kann, tut besser daran. sich nicht ans Voltigieren zu wagen.
Kurt Tucholsky zum Beispiel wusste sehr wohl, dass man nur Adjektive steigern kann aber keine Pronomina. Und doch kennzeichnete er einen aufgeblasenen Unteroffizier auf den Punkt genau mit der grammatikalisch total falschen Formulierung: „Je lauter er schrie, desto niemander kam.“
Worauf mein Deutschlehrer am Gymnasium, der ein strenger Mann war und Regeln um ihrer selbst willen liebte, gesagt haben würde: „Setzen, Tucholsky. Note drei.“
Noch so ein Problemschüler ist Wilhelm Busch, der als Dichter immer unterschätzt wird, weil er als Zeichner so brillant war. Er gab einmal dem Verb „anbeten“ eine völlig falsche Bedeutung, indem er es unorthodoxer Weise eine Fortbewegungsart bezeichnen liess. Aber kann man frömmelnde Pilger genauer kennzeichnen als es in diesen Versen aus der „Frommen Helene“ geschieht?
„Doch die Erzgebruderschaft
Nebst den Jungfern tugendhaft,
Die sich etwas sehr verspätet,
Kommen jetzt erst angebetet.“
Busch, Wilhelm, so geht das nicht.
Wenn wir schon bei den falsch und gerade deshalb richtig verwendeten Verben sind, hier noch ein Beispiel aus „Annebäbi Jowäger“: „Der Vikari“, schreibt Gotthelf da, „schmiss sich schmetternd aus der Türe.“
Ich bin sicher, mein Professor, der hier namenlos bleiben soll, hätte dem Schüler Bitzius diesen Satz dick unterstrichen und am Rand mit vorwurfsvollem Rotstift angemerkt: „Deutsch!!!“
Aber eben: In den Händen eines wirklichen Könners wird auch falsches Deutsch zu richtigem Deutsch. Da macht die Sprache die verwegensten Kunststücke, ohne dabei vom hohen Seil zu fallen.
Manche mögen das nicht. Aber wer der Meinung ist, dass man beim Schreiben lechts und rinks niemals velwechsern dürfe, der soll eben nicht Ernst Jandl lesen.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 31. Mai 2015,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats Juni
Manche Bücher muss man probieren, andere verschlingen, und einige wenige muss man kauen und verdauen.
Francis Bacon
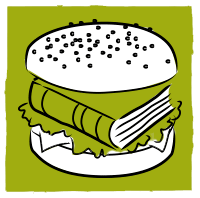
Lies nicht so gierig! Wenn du dir schon Fast-Food-Romane reinziehen musst, solltest du sie wenigstens nicht am Stück runterschlingen. Das ist nicht gut für die geistige Verdauung. Wenn dir mitten in einer gepflegten Unterhaltung der Inhalt wieder aufstösst, wer muss sich dann schämen? Wir! Die Leute müssen ja denken, bei uns zuhause käme überhaupt nie ein anständiges Buch auf den Tisch.
Warum nimmst du dir nicht ein Vorbild an deinen Eltern? So ein Robert Walser, in winzigen Portionen genossen… „Der Gehülfe“ zum Beispiel. Nein, nicht Gehilfe! Gehülfe. Das ist eben die ganz feine Würzung. Das muss man sich auf der linken Gehirnhälfte zergehen lassen. Aber du…
Was sagst du? Davon wird man nicht satt? Literatur ist nicht zum Sattmachen da! Sonst wäre Karl May der grösste Dichter, den es je gegeben hat. Weisst du, was man von solchen Büchern bekommt? Gehirnverstopfung! Und verfettete Bücherregale von all den Erzähl-Kalorien!
Nein, ich rege mich nicht auf. Ich bin nur enttäuscht von dir. Dich kann man ja nicht mal in eine bessere Bibliothek mitnehmen, ohne dass du einen blamierst. Beim letzten Mal hast du allen Ernstes gefragt, was E.T.A. Hoffmann ausser dem „Jedermann“ noch geschrieben habe. Deine Mutter war einer Ohnmacht nahe. Unser Sohn und kennt noch nicht mal den Unterschied zwischen Hoffmann und Hofmannsthal. Zum Glück hatte ich das Fläschchen mit den Hoffmannstropfen dabei.
Und warum musst du immer genau dann dringend Aufgaben machen, wenn wir uns am Fernsehen den „Literaturclub“ ansehen? Die Sendung, in der die angesagten Literatur-Rezepte besprochen werden.
Was soll das heissen: „Die Leute, die dort auftreten, können selber gar nicht kochen“? Seit wann muss man kochen können, um kluge Dinge übers Essen zu sagen? Ein Ballettkritiker geht auch nicht im Tutu ins Theater!
Aber weisst du, was deine schlechteste Angewohnheit ist? Dass du auf einem E-Book liest! Wo man noch nicht mal weiß, wo man sein Exlibris einkleben soll. Wenn Gott gewollt hätte, dass wir E-Bücher lesen, hätte er die Fadenheftung nicht erschaffen.
Wir verlangen ja nicht, dass du Romane von Murakami mit Stäbchen isst, oder dir deinen Bashevis Singer nur im koscheren Restaurant bestellst – aber ein bisschen Stil sollte schon sein.
Merk dir das endlich, mein Sohn: Ein zivilisierter Mensch liest nicht einfach nur zum Vergnügen!
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 28. Juni 2015,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats Juli/August
Die Kunst des Lesens ist die Fähigkeit, Seiten zu überblättern, auf denen man nichts versäumt.
William Butler Yeats
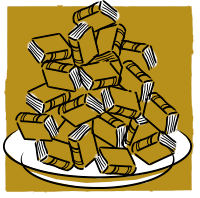
Amazon, dieser Lord Voldemort des Buchhandels, hat auch ein „All you can read“-Programm, bei dem man sich für eine fixe monatliche Gebühr so viele Bücher auf seinen Kindle laden kann, wie man will. Jeder, den ein böses Schicksal jemals an ein „All you can eat“-Buffet verschlagen hat, weiss, wie sich das auswirkt: Die Leute packen sich ihre Teller bis an den Rand mit Essen voll, probieren von allem ein bisschen und lassen dann die Hälfte stehen. Auf die Lektüre bezogen: Sie laden viel mehr Bücher aus dem Netz herunter, als sie dann auch tatsächlich lesen.
Bis jetzt wurden die Autoren, deren Werke auf diesem elektronischen Buffet angeboten werden, danach bezahlt, wie oft ein Buch heruntergeladen wurde. Jetzt führt Amazon ein neues System ein: die Bezahlung nach gelesener Seite.
Denn so ein Kindle kontrolliert einen beim Lesen permanent, und Amazon weiss ganz exakt Bescheid darüber, ob seine Kunden auch brav alle Seiten aufrufen oder einfach mal ein Kapitel überspringen.
Die üblichen Empörten haben sich auch über diese neue Drehung an der Kommerzialisierungsschraube pflichtgemäss empört, aber das eigentliche Unheil, das den Kindle-Lesern damit droht, haben sie alle nicht erkannt: Wenn Amazon weiss, welche Seiten ich in einem Buch überblättert habe, dann wird es nicht lange dauern, bis es auch der Autor erfährt.
Und dann wird früher oder später ein wütender Kollege vor meiner Türe stehen und mit vorwurfsvoller Miene wissen wollen: „Was, zum Teufel, hat Ihnen an Seite 87 bis 104 nicht gefallen?“
Und ich muss ihm dann erklären, dass ich leider für endlose Landschaftsbeschreibungen wenig übrig habe, dass ich seine Dialoge langfädig fand, oder dass ich hoffte, irgendwann würde der philosophische Exkurs zu Ende sein und die Handlung wieder weitergehen. Vielleicht habe ich auch gerade meinen ehrlichen Tag und sage ihm, dass ich sein Buch schlicht und einfach langweilig fand, und schon geht der Kollege auf mich los schlägt mich k.o.
Noch schlimmer: Ich kann noch nicht einmal mehr aufschneiden und behaupten, ich hätte sämtliche Bände Knausgaard von A bis Z gelesen, denn irgendwann werde ich dann in den unsozialen Netzwerken unweigerlich als Hochstapler entlarvt.
Und das alles nur, weil Amazon alles über die Lesegewohnheiten seiner Kunden weiss. Zum Glück (psst, nicht weitersagen!) gibt es Bücher auch aus Papier.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 30. August 2015,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats September
Der Abschied von einer langen und wichtigen Arbeit ist immer mehr traurig als erfreulich.
Friedrich Schiller
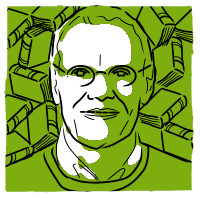
Der Tag, an dem Urs Rauber die Bücher am Sonntag verliess, war ein trauriger Tag. In allen Bibliotheken des Landes wurden die Kataloge auf Halbmast geflaggt, in den Buchhandlungen trugen die Verkäufer Trauerflor, und der Literaturclub wurde zum Zeichen des Leides in schwarz-weiss gesendet. Sogar in der Kantine der NZZ wurde zum Essen nur Schwarzbrot serviert.
Die Schweizer Autoren schritten allesamt gemessenen Schrittes in die nächste Beiz und bestellten dort einen Schierlingsbecher. Als das Rösi und das Mädi nicht wussten, was das war, begnügten sie sich mit einem Bier, bestanden aber in Anbetracht des tragischen Anlasses auf einem dunkeln. Und bevor sie den ersten Schluck nahmen, liessen sie bittere Zähren in das Gebräu fallen. (Eigentlich hätten Tränen auch gereicht, aber wozu hat man ein Synonymlexikon?)
Sogar die Sendung Glanz und Gloria befasste sich an diesem schweren Tag mit Büchern, allerdings erst, nachdem man den Präsentatorinnen erklärt hatte, was ein Buch ist. Sie erklärten es dann ihrerseits den Zuschauern. „Urs Rauber“, sagten sie, „das war der Mann, der sich mit Kindles aus Papier beschäftigte.“
Als dann die düstere Stunde kam, und er schweren Schrittes und mit gebeugtem Haupt die Redaktionsräume verliess, kniete links und rechts ein Spalier von unbezahlten und deshalb zum Trauern besonders geeigneten Volontären, und der Chor der Literaturpreisverleiher stimmte ein dissonantes Lied an. (Sie hatten sich, wie so oft, auf keinen Titel einigen können.) Felix E. Müller trug ein selbstverfasstes Gedicht vor, das er sich von einem Assistenten hatte schreiben lassen, und dessen tiefsinnige Worte noch lang in den heiligen Hallen der NZZ nachklingen werden: „In des Hauses tiefsten Gründen ist kein Rauber mehr zu finden.“ Dann segnete Papst Manfred persönlich den Abtretenden, und zu seinen Ehren wurde ein zwei Meter hoher Stapel seiner Manuskripte in Brand gesetzt.
Ach, es war ein schwerer Tag, und es liesse sich noch seitenlang von all den tragischen Szenen der Verzweiflung berichten, die sich in der eidgenössischen Literaturwelt, bei Schreibenden und Lesenden. abspielten. Aber wie hatte es doch Urs Rauber in seiner unvergesslich präzisen Diktion einmal so richtig formuliert? „Bitte halte dich an die 2350 Zeichen, sonst passt Dein Text nicht ins Raster.“
In seinem Angedenken wollen wir uns stets daran halten.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 27. September 2015,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«
Glosse des Monats Oktober
Die Höhlung, welche das geniale Werk in das uns Umgebende gebrannt hat, ist ein guter Platz, um sein kleines Licht hineinzustellen.
Franz Kafka

Es gibt Momente, da kommt man sich als Autor vor wie ein ganz brauchbarer Tennisamateur aus der Regionalliga, der gerade gegen Roger Federer hat antreten müssen. 6:0, 6:0, 6:0, und der starke Aufschlag oder die gute Rückhand, auf die man auf der Vereinsebene ein bisschen stolz sein konnte, sind plötzlich überhaupt nichts mehr wert. Man hat – manchmal ist die deutsche Sprache so präzis wie das Skalpell eines Chirurgen – seinen Meister gefunden.
Was tut man in dieser Situation? Das Tennisspiel aufgeben und es in Zukunft mit Boccia probieren? Weil man weiss, dass man auch nach hundert Jahren täglichen Trainings nie so gut sein wird wie Roger? Oder, um von der Metaphernebene in die Wirklichkeit der Schriftstellerei zurückzukehren, soll man das Schreiben aufgeben, weil man gerade ein Buch gelesen hat, dessen Qualität man auch in seinen besten Momenten nicht erreichen wird? Weil man weiß, dass dieser Autor schon im ersten Entwurf besser schreibt als man selber in der zwanzigsten polierten Fassung?
In meinem Fall war es eine Autorin. Ich habe gerade Hilary Mantels Jugenderinnerungen „Giving Up the Ghost“ zu Ende gelesen (auf Deutsch scheusslicherweise nicht als „Den Geist aufgeben“ sondern als „Von Geist und Geistern“ übersetzt), und ich sitze immer noch fassungslos da und frage mich: Wie kann jemand so gut schreiben?
Dabei faszinieren Memoiren in der Regel mehr wegen der darin geschilderten Erlebnisse als wegen der Brillanz ihrer Form. Und was Hilary Mantel zu beschreiben hat, ist nicht einmal so wahnsinnig aufregend, sie war ein unangepasstes, spökenkiekerisches Kind und litt später viele Jahre unter einer schweren Krankheit – so what? Aber wie sie das beschreibt, wie auf jeder Seite die Beobachtungen und Erkenntnisse aufblitzen wie frisch geschliffene Diamanten, wie sie nicht nur in jedem Satz die richtigen Worte findet, sondern immer mal wieder die unpassenden und deshalb umso richtigeren, das hat mich umgehauen.
Und jetzt? Soll ich konsequenterweise das Schreiben aufgeben, weil man gegen Roger Federer ja doch keine Chance hat? Soll ich anfangen Briefmarken zu sammeln oder den Eiffelturm aus Streichhölzern nachzubauen?
Ich werde, getröstet von Franz Kafka, weiter schreiben. Auch die kleinen Lichter haben ihren Platz. Und manchmal wachsen im Schatten der grossen Bäume ja auch ganz hübsche Blumen.
Erschienen in »Bücher am Sonntag« vom 25. Oktober 2015,
Literaturbeilage der »NZZ am Sonntag«

